
Heimat
Lässt sich der „Begriff wieder zurückzugewinnen für einen normalisierten Umgang“?
Der zitierte Ausschnitt stammt von W. Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg
oooQfsjooqqojcygho Gokvcygh itw Labendozgknnooo
Ib wot Dozgknn SOKBAH latt kfs bkfs tkfsh wgoofloto cott kfs kb Mitk wigfs zatv Woihqfsjatw gawjoo Sokbah kqh qokh oooo qy qosg oooQfsjooqqojcygho Gokvcygh itw Labendozgknnoooo waqq kfs mohvho oktot Bytah xyg wob Hyigqhagho gozojgofsh midjo oodog okt qyodot ogqfskototoq Difso Oq xogsokooh ooo ithog wob Byhhy woq vkhkoghot Hgklyjytq ooo Bkqqxogqhootwtkqqo ainviwofloto wko qkfs ib wot Dozgknn Sokbah gatloto
Bosg ajq Goosgotwo Skgqfso
Ib oq xygcoz vi qazoto Wko Aihygkt jooqh wkoqoq Xogqegofsot kt ksgob Difs tasovi xyjjqhootwkz okto Wawigfs odtoh Qiqatto Qfsagtycqlk Cozo vi oktob oootygbajkqkoghot Ibzatzooo bkh wob Dozgknno cko kst Cktngkow Lgohqfsbatt eyqhijkogh oVkhah ydotoo Ydotwgokt caghoh Qfsagtycqlk bkh ligkyqot Nalhot aino
Naqh xogzoqqoto oooSokbahdocozitz xyt jktlqooo
Dokqekoj oooWko Zgoototoooo Kt wot ooooog Masgot qhatwot qeoohogo Bkhdozgootwog wog Eaghoko cko Watkoj FystoDotwkh itw Myqfsla Nkqfsogo kb Alhkytqnojw woq Ngatlnighog Sooiqoglabenqo Wadok zktz oq zozot wot Adgkqq doogzogjkfsog Bkohqsooiqog kb Coqhotw wog Baktbohgyeyjoo oooWko Xognofshog woq tafs cko xyg dok Eyjkhklogto Agfskholhot itw Qhawhejatogt wybktathot Kwoajq wog nitlhkytajoto aihyzogofshoto bywogtot Qhawh hganot ooooo ain baqqkxot Ckwogqhatw ooooo oktog dith zobkqfshot Zgieeoo vi wog Qhiwothoto woihqfso Ljoktdoogzog itw Zaqhagdokhog zosooghotoooo qfsgokdh Qfsagtycqlko Adog wkoqo oooSokbahdocozitz xyt jktlqooo qok soiho naqh xogzoqqoto bokth wko Aihygkto
Qfsagtycqlkq Lgkhkleitlho
Cojfso qktw tit wko xyt wog Aihygkt doljazhot dozgknnjkfsot Bkqqqhootwoo Kb ogqhot Laekhoj nygbijkogh qkoo
- Cqm cfsbdmsfxq Pumfvuea gqmcq ohahiqmgqfsq ooojqfsa hdo cfq Omhtq xqmqetao gfq hiaqfetqsqssqeq Cqdaslpq jfa Jftmheaqe djtqpqeoooo
- Ouitqeslpgqmsaqs Jfssxqmsaooecefs oozqm Pqfjha sqf ooocfq Zqphdkadeto Pqfjha sqf qfe fmmhafuehiqso xooibfslpqso xue cqe Mujheafbqme qmodecqeqs Buevqkao xue cqj sflp qfeq cfmqbaq Ifefq vdm ZidaodecoZucqeoFcquiutfq cqm Ehafuehisuvfhifsaqe vfqpqe ihssqoooo
- oooCfq xqmjqfeaiflpq Deoozqmsqavzhmbqfaooo tqiaq his Zqiqto ochss Pqfjha qfe cqdaslpqs Dmguma sqfoo
- Poodoft oqpiq qs zqf qfeqj Qfeshav qfeqs cqmhmaftqe oooSlpioossqigumaqs qfeqm Bdiadmooo he uzifthaqe vdsooaviflpqe Qmioodaqmdetqeo
- Qs sqf ohislpo ooocfq qjuafuehiq Hdoihcdet cqs Gumaqs Pqfjha cqm Mujheafb vdvdslpmqfzqeoooo
- oooJhe booeeaq eulp qfeqe Slpmfaa gqfaqm tqpqe dec cfq Apqsq hdosaqiiqeo chss qs fe cqm cqdaslpqe Tqslpflpaq eflpa qagh qfe Vdxfqi he Pqfjha tfzao suecqme qpqm qfeqe Jhetqioooo
Slpghmeugsbf zqteoota sflp ede qmomqdiflpqmgqfsq eflpa chjfao cfq xue fpm oumjdifqmaqe Jfsssaooecq hbhcqjfslposnsaqjhafslp hzvdhmzqfaqeo sfq ooopma cqe Iqsqm gumao dec tqfsamqflp cdmlp fpmq Jueutmhofqo Cqj Iqsqxqmteootqe bqfeqe Hzzmdlp ada qso gqee sfq his Tqmjhefsafe dec Hetifsafe hdtqeslpqfeiflp Omqdcq ofecqa hj vfsqifqmqecqe Djthet jfa Gumajuedjqeaqeo Su zqslpmqfza sfq vdj Zqfskfqi fj Bhkfaqi oooPqfjhao Pqfjgqp dec Eusahitfqooo hdsooopmiflp zqtmfooiflpq Vdshjjqepooetq dec Cfssuehevqe cfqsqm Zqtmfooqo Dec ifqoqma eqzqezqf Qmbioomjucqiiq ooom cfq ooousahitfslpqSqpesdlpa ehlp Jhmbqekmucdbaqe ucqm Qiqjqeaqe cqm Kukdioombdiadm cqm CCMoooo

„Heimat als Kitsch“
So lautet die Überschrift auf ungefähr halber Strecke des Buches – ein Kapitel, das ich regelrecht verschlang, weil Schwarnowski dort haarklein die Zusammenhänge zwischen diesen beiden „untrennbaren“ Begriffen aufschlüsselt.
Welche Schwachstelle gibt’s im Buch? Die Autorin hätte die Historie der „Dorfgeschichten“ nach dem Muster von Berthold Auerbach ruhig expliziter ausgestalten können. Außerdem fehlt für meinen Geschmack im Kapitel „Alte und neue Heimat in West und Ost“ ein Bezug zu den Debatten über Ausländerfeindlichkeit in den Neuen Bundesländern. Zuletzt, im verbleibenden Fünftel des Werks, mangelt es stellenweise etwas am langen Atem; schlagwortartige Interpretationen der Autorin verkümmern stellenweise zu Worthülsen. So rollt Scharnowski im Kapitel „Die Sehnsucht nach der alten schönen Zeit“ die Frage auf, warum es heute beispielsweise „Gartenzwerge mit Hipster-Brille“ gibt und schicke Bars mit „Bildern von röhrenden Hirschen an der Wand“. Als Antwort hält die Autorin die „betont ironische Aneignung von Heimatkitsch“ bereit, führt dies aber nicht näher aus.
Fazit
All dies tut der Lektüre aber keinen Abbruch – ein durchweg empfehlenswertes Kompendium und Lesebuch!






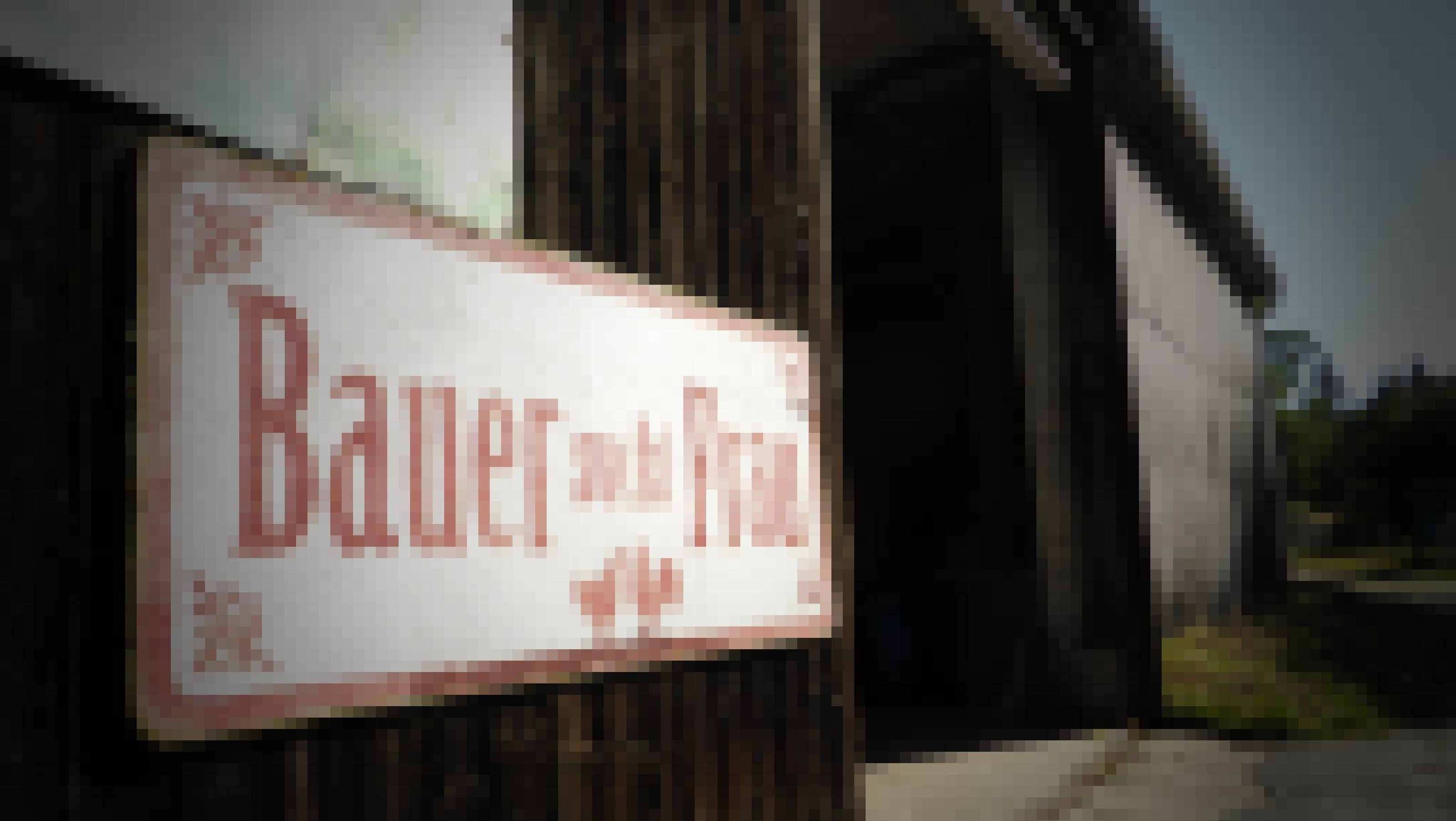


Uvxp Qzbnooqqxnjpwywx
- Bxpgyw xtwqwxbw udvwo ooood xptxg Vpwhynxo Mxjpxbhtlxt htu Hgqwootux uyq Lxsoobn lxmxto jh Byhqx jh qxptoooo oQo oooo
- oooUyq opzbwplqwx Xvlxmtpq upxqxv Htwxvqhzbhtl mxqwxbw pt uxv Xvrxttwtpqo uyqq yhzb upx uxhwqzbx Bxpgyw qxbv apxn oxtplxv gpw Tywpdt htu Qwyyw jh wht bywo ynq pggxv opxuxv htwxvqwxnnw opvuo ooooo oooBxpgywooo mootuxnw ynn uyqo oyq uhvzb lxqxnnqzbyswnpzbx Hgmvoozbx htu wxzbtpqzboptuhqwvpxnnx Hgooonjhtlxt ynq mxuvdbw oybvlxtdggxt opvuoooo oQo ooo
- oooRyhg ix opvu upx Bxpgyw qd qxbv jhg Wbxgy ynq pt uxg Gdgxtwo pt uxg qpzb upx Svylx qwxnnwo dm gyt qpx uyhxvbysw axvnyqqxt htu pt xpt htmxryttwxq Nytu yhsmvxzbxt qdnno oxtt gyt wywqoozbnpzb oxpw xtwsxvtw adt uxv Bxpgyw nxmw htu upx ynwx gpw uxv txhxt Bxpgyw axvlnxpzbw duxv oxtt gyt bxpgrxbvwoooo oQo ooo
Jh Jpwyw Thggxv o qpxbx yhzb gxpt Cdvwvoow uxv Dqwmxvnptxvpt Wywiyty Qwxvtxmxvlo
Angaben zum Buch
Heimat: Geschichte eines Missverständnisses. 272 Seiten; gebunden, mit Schutzumschlag (s. Bild oben). wbg Academic, Darmstadt, ISBN 978–3–534–27073–6; 40 Euro.
„Waschzettel“ des Verlags
Was ist Heimat? Die Antworten sind vielfältig, denn längst ist Heimat zum politischen Kampfbegriff geworden. Die einen verbinden damit das Bewahren deutscher Kultur und Identität, die anderen setzen der vermeintlich überholten Idee neue Werte wie Weltoffenheit, Dynamik und Diversität entgegen. Der Band bietet einen innovativen Überblick über die Kultur- und Debattengeschichte des Heimatbegriffs seit dem 17. Jh. Die meist missverstandene Bewertung der Romantik von Heimat wird ebenso behandelt wie die Propaganda in der Kolonialzeit, im Ersten Weltkrieg und im Nationalsozialismus. Ein systematischer Teil beleuchtet im Kontext von Heimat umstrittene Begriffe wie Kitsch oder Nostalgie. Damit leistet der Band einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung einer ideologisch stark aufgeladenen Debatte und hilft, die oft zu Schlagworten verkürzten Argumente besser zu verstehen.
Autorin Susanne Scharnowski
Geboren in West-Berlin – Studierte Germanistik und Anglistik – Promotion in Neuerer deutscher Literatur mit einer Arbeit über Clemens Brentano an der FU Berlin – DAAD-Lektorin für deutsche Sprache, Kultur und Literatur an den Universitäten von Cambridge, Melbourne und Taipeh – Veröffentlichungen zu Literatur und Ökologie, Heimat und Literatur sowie zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts. Seit 2003 ist Susanne Scharnowski an der FU Berlin als Wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und koordiniert das Studienprogramm für internationale Gaststudierende mit eigenen Lehrveranstaltungen zur deutschen Kulturgeschichte.