- RiffReporter /
- Wissen /
Was von der viel zitierten Studie zu Hydroxychloroquin bei Covid zu halten ist
Hilft Hydroxychloroquin gegen Covid? Eine kritische Analyse einer viel zitierten Studie
Warum die Hoffnung auf Hydroxychloroquin im Moment nicht berechtigt ist
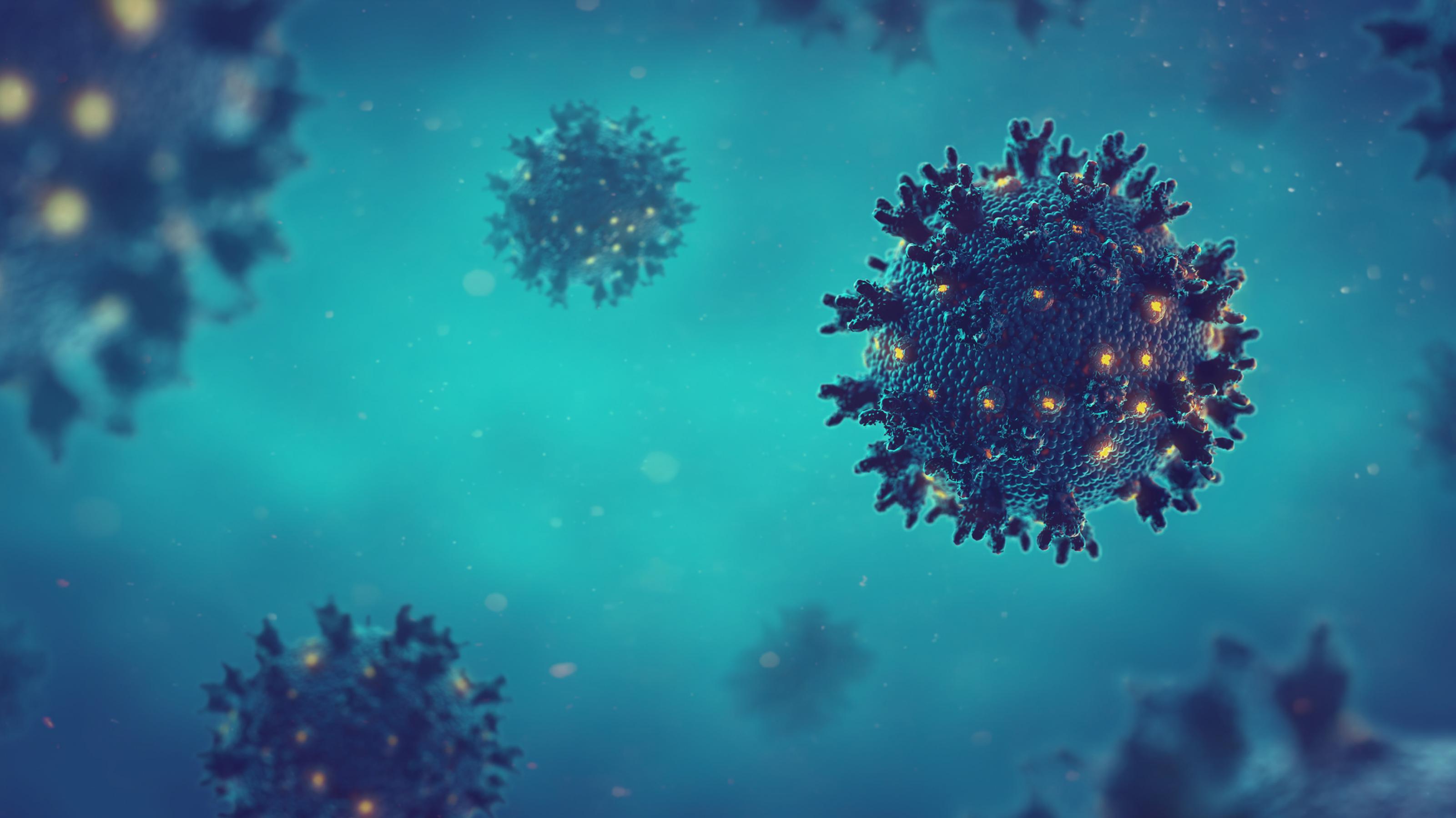
Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.
Update 18.06.2020:Am 17.06.2020 hat die WHO bekannt gegeben, dass in den Hydroxychloroquin-Arm der SOLIDARITY-Studien keine weiteren Patient*innen aufgenommen werden. In diesen Studien wird die Behandlung von akut erkrankten Patient*innen untersucht.
Update 16.06.2020: In Sachen Hydroxychloroquin hat sich inzwischen eine Menge getan. Es sind noch eine Reihe weiterer Studien erschienen, von denen viele keine Nutzen von Hydroxychloroquin bei Covid-19 feststellen konnten. Andere Untersuchungen laufen weiter. Auf der Basis einer inzwischen wieder zurückgezogenen Studie hatte die WHO Untersuchungen mit dem Mittel zunächst gestoppt, dann aber wieder aufgenommen. Die FDA hat dem Mittel eine Erlaubnis zum Notfallgebrauch erteilt und schließlich wieder entzogen. Die Begründung: Angesichts der bisherigen Studienergebnisse sieht es nicht so aus, als ob Hydroxychloroquin tatsächlich nützt, und die Abwägung von Nutzen und Risiken fällt inzwischen negativ aus.
In Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles anders. Was sonst Jahre und Jahrzehnte dauert, spielt sich gerade im Zeitraffer ab. Wir erleben live, wie Wissenschaft funktioniert, wie Erkenntnisse entstehen, vermeintliche Einsichten wieder verworfen werden und Expert*innen zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Und es wird auch deutlich wie sonst selten, dass Unsicherheit zum Kerngeschäft der Wissenschaft gehört. Auf dieser unsicheren Basis müssen zeitnah Entscheidungen getroffen werden: (gesundheits-)politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche.
Dennoch ist vieles trotz der höheren Geschwindigkeit doch gleich: Zum Beispiel, dass wir Gesundheitsentscheidungen trotz Unsicherheit nicht einfach aufschieben können – denn das hätte auch Konsequenzen. Das haben wir vor einiger Zeit hier beschrieben.
In der Coronakrise konzentriert sich im Moment vieles auf eine sehr alte Frage: Wie können wir eigentlich herausfinden, ob bestimmte Medikamente helfen? In diesem Fall eben bei Covid-19. Derzeit werden eine ganze Reihe von Wirkstoffen diskutiert – zugelassen ist allerdings keiner für diesen Zweck, nur für andere Anwendungsgebiete. Ein Grund dafür: Bisher wurden die Mittel nicht oder nicht ausreichend in klinischen Studien mit Corona-Patient*innen untersucht.
Eine kurze Vorstellung der aussichtsreichsten Kandidaten gibt es in der FAQ der Corona-Koralle bei Riffreporter.
Warum Erfahrungswerte allein nicht reichen
Warum aussagekräftige Studien notwendig sind und man sich nicht auf Erfahrungswerte verlassen darf, ist eine Dauerbrenner-Frage. Eins der wichtigsten Argumente für Studien gilt besonders bei den Corona-Infektionen: Wie stark jemand erkrankt, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Wir kennen zwar einige Risikofaktoren für schwere Verläufe, etwa höheres Alter oder Vorerkrankungen, allerdings gibt es inzwischen einige Berichte, dass auch jüngere gesunde Menschen an der Infektion und ihren Folgen verstorben sind. Aus den Ergebnissen einzelner unsystematischer Behandlungen lässt sich also nichts Verlässliches zum Nutzen der Medikamente schlussfolgern. Mehr dazu, wie Erfahrungswerte täuschen können, kannst du übrigens in einem früheren Artikel bei Plan G lesen.
Problematische Studie mit Hydroxychloroquin
Allerdings gibt es inzwischen auch einzelne Studien mit verschiedenen Medikamenten. Die sind jedoch oft nur klein und meist nicht besonders aussagekräftig. Das hält aber viele nicht davon ab, ihren Einsatz lautstark zu befürworten – so wie es etwa kürzlich US-Präsident Trump mit dem Mittel Hydroxychloroquin getan hat. Anlass war die Veröffentlichung einer Studie, die in Frankreich durchgeführt wurde [1]. Und die hat das Potenzial – nein, nicht dem Medikament zum Durchbruch zu verhelfen –, sondern eins der besten Negativ-Beispiele dafür zu werden, was an Studien zum Nutzen von Medikamenten problematisch sein kann.
Viele Probleme von Studien haben wir bereits allgemein bei Plan G beschrieben. Aber was heißt das konkret für diese Studie mit Hydroxychloroquin? [2] Damit die Zusammenhänge deutlicher werden, haben wir dir unsere früheren Artikel, die zum jeweiligen Aspekt gehören, im weiteren Text verlinkt.
Keine zufällige Zuteilung
An der Studie haben insgesamt 42 Patient*innen teilgenommen, die wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in einer der beteiligten französischen Kliniken behandelt wurden. Von ihnen bekamen 26 Hydroxychloroquin (sie waren also die Behandlungsgruppe), die anderen 16 nur die übliche Krankenhausbehandlung. Diese bildeten also die Kontrollgruppe.
Das erste Problem ist natürlich die kleine Fallzahl. Je kleiner eine Studie ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit für zufällige Befunde – es ist also fraglich, ob die Ergebnisse wirklich verallgemeinerbar sind.
Das noch größere Problem: Die Patient*innen wurden nicht nach dem Zufallsprinzip auf die Behandlungsgruppen verteilt. Das Zufallsprinzip, also eine Randomisierung, würde dafür sorgen, dass die Ausgangsbedingungen bei den Behandelten möglichst ähnlich sind, damit auch wirklich „Gleiches mit Gleichem“ verglichen wird. Was in der Studie zum Beispiel auffällt: Die Patient*innen in der Behandlungsgruppe waren im Durchschnitt deutlich älter als die Patient*innen in der Kontrollgruppe, mehr von ihnen hatten Symptome und die Lunge war häufiger von der Infektion betroffen. Ob und wie das die Ergebnisse beeinflusst haben könnte, bleibt unklar.
Vergleichbare Umstände?
Was auch unklar bleibt: Werden die Patient*innen tatsächlich alle gleich behandelt – abgesehen von Hydroxychloroquin? Das bleibt zum Beispiel deshalb fraglich, weil die Patient*innen mit Hydroxychloroquin alle in einem einzigen Krankenhaus behandelt werden, die aus der Kontrollgruppe insgesamt in vier verschiedenen Kliniken.
Ob die sonstigen Behandlungen und die Pflege vergleichbar sind, geht aus der Publikation nicht hervor. Es fällt aber auf, dass einige – nicht alle – der Patient*innen in der Behandlungsgruppe zusätzlich noch das Antibiotikum Azithromycin erhalten. Dass ausgerechnet diese sechs Patient*innen dann in der Studie besser abschneiden, kann auch genauso gut Zufall sein und muss nicht mit dem zusätzlichen Antibiotikum zusammenhängen. Um das herauszufinden, hätte man auch das Azithromycin zufällig auf die Gruppen verteilen müssen.
Wer fehlt?
Eins der markantesten Probleme der Studie ist die Art und Weise, wie sie die Daten auswertet: Von den insgesamt 42 Patient*innen wurden nur die Daten von 36 berücksichtigt. Die restlichen sechs wurden nicht analysiert, weil sie starben, auf die Intensivstation verlegt wurden oder nicht mehr an der Studie teilnehmen wollten. Allerdings gehörten alle sechs zu der Gruppe, die Hydroxychloroquin bekommen hat – in der Kontrollgruppe wurden alle Daten gezählt. Das verzerrt natürlich die Ergebnisse der Untersuchung.
Was wird gemessen?
Wichtig ist bei einer Studie auch immer, was eigentlich genau gemessen wird. Und in diesem Fall war die wichtigste Größe, also der so genannte primäre Endpunkt, der Anteil der Patient*innen, bei denen sich an Tag 6 nach Aufnahme in die Studie kein Virus mehr im Nasen-Rachen-Raum nachweisen ließ.
Ist das ein Endpunkt, der für Patient*innen wichtig ist? Wohl kaum. Für sie ist es viel wichtiger, wie lange sie zum Beispiel im Krankenhaus bleiben müssen oder ob sie überhaupt überleben. Das wurde in der Studie aber nur unter „ferner liefen“ untersucht (sekundäre Endpunkte) und diese Ergebnisse tauchen in der Publikation auch gar nicht auf.
Warum die Frage nach dem Virusnachweis außerdem nicht weiterhilft: Hydroxychloroquin kann das Herz schädigen und dadurch auch zum Tod führen. Dieser Effekt kann durch Azithromycin übrigens noch verstärkt werden. Hydroxychloroquin wäre sinnlos, wenn es zwar möglicherweise gegen das Virus hilft, aber gleichzeitig die Sterblichkeit erhöht. Um herauszufinden, ob das Mittel oder die Kombination wirklich mehr nützt als schadet, müssten also die Gesamteffekte untersucht werden – bei schwerkranken Patient*innen also zum Beispiel die Gesamtsterblichkeit.
Was die WHO besser macht
Auf der Basis der französischen Studie lässt sich also keine belastbare Aussage treffen, ob Patient*innen mit Covid-19 tatsächlich gut beraten sind, Hydroxychloroquin einzunehmen. Deshalb ist es eine gute Sache, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt große Studien angestoßen hat, in der Hydroxychloroquin neben anderen Medikamenten getestet werden soll.
Und diese Studien machen vieles richtig [3]:
- Sie sollen in mehreren Ländern laufen und viele Patient*innen einschließen – damit lassen sich verlässlichere Ergebnisse erzielen als mit einer kleinen Untersuchung in nur einem einzigen Land.
- Sie sind randomisiert, teilen also die Medikamente nach dem Zufallsprinzip zu. Das sorgt für eine gute Vergleichbarkeit der Behandlungsgruppen.
- Sie vergleichen Medikamente mit der sonst üblichen Krankenhausbehandlung – damit lässt sich abschätzen, ob Medikamente überhaupt einen Mehrwert haben, was je nach Land möglicherweise auch noch unterschiedlich ist.
- Der wichtigste Endpunkt ist die Gesamtsterblichkeit – damit wird ein Aspekt untersucht, der für schwerkranke Patient*innen höchst relevant ist und auch schwere Nebenwirkungen der Medikamente berücksichtigt.
Wenn du noch mehr zu den geplanten Studien lesen willst: Unser Riffreporter-Kollege Kai Kupferschmidt hat das ausführlich aufgeschrieben.
Zum Weiterlesen
[1] Die Studie wurde Mitte März auf einem Preprint-Server veröffentlicht und wenige Tage später in der Fachzeitschrift „International Journal of Antimicrobial Agents“ publiziert. Gautret P et al. Hydroxychloroquine and Azithromycin as a treatment of COVID-19: preliminary results of an open-label non-randomized clinical trial.
Die medizinische Fachgesellschaft, die das Journal herausgibt, hat sich inzwischen von der Veröffentlichung distanziert.
[2] Die Studie hat außer den hier beschriebenen noch einige weitere methodische Probleme, die die Aussagekraft deutlich einschränken. Mehr Details finden sich etwa auf der Online-Plattform PubPeer, auf der Wissenschaftler*innen wissenschaftliche Artikel nach der Veröffentlichung diskutieren (post-publication review). Weitere Aspekte hat auch die Mikrobiologin und Expertin für wissenschaftliche Integrität Elisabeth Bik auf ihrem Blog zusammengetragen.
[3] Details zum Design der SOLIDARITY-Studien findest du im Studienregister der WHO.