Drei Dinge, die du über Angaben auf Lebensmitteln wissen solltest
Wie du besser in Sachen Ernährung entscheiden kannst

Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.
Eine Salami, die leichter ist. Eine Margarine, die den Cholesterinspiegel senkt. Ein zuckerreduziertes Müsli. Hört sich gut an. Aber sind solche Lebensmittel wirklich gesünder oder helfen beim Kaloriensparen?
Auf den Verpackungen von Lebensmitteln begegnen dir Informationen, die nicht unbedingt für sich selbst sprechen: Was genau heißt eigentlich fettreduziert? Oder light? Sind das automatisch die besseren Alternativen? Was bedeuten die Angaben auf den Vitamintabletten? Und wie muss man die Ampel verstehen, die auf manchen Lebensmitteln abgebildet ist?
Was hinter welcher Bezeichnung steckt, ist ziemlich genau geregelt. Wenn du diese Regeln kennst, fällt dir auch die Einkaufsentscheidung leichter. Allerdings steckt der Teufel wie so oft im Detail: Denn es gibt zwar eine ganze Reihe von gesetzlichen Vorgaben, allerdings klaffen dort noch einige Lücken. Und einige Hersteller kennen die Schlupflöcher ganz genau.
Das Wichtigste in Kürze
- Für Angaben wie zuckerreduziert gibt es gesetzliche Vorgaben. Allerdings sind das immer relative Angaben. Andere Lebensmittel können also insgesamt deutlich weniger Zucker enthalten.
- Für Nahrungsergänzungsmittel sind bestimmte gesundheitsbezogene Aussagen erlaubt. Allerdings bedeuten sie nicht immer das, wonach es auf den ersten Blick aussieht.
- Der Nutri-Score kann einen schnellen Vergleich ähnlicher Lebensmittel erleichtern, löst aber nicht alle Informationsprobleme rund um eine gesunde Ernährung.
1. Irgendwie leichter?
Der Käse ist fettarm, das Müsli zuckerreduziert und die Salami light – das hört sich erstmal gut an, wenn du Kalorien sparen willst. Und tatsächlich gibt es auch Regeln, wann Hersteller solche Bezeichnungen auf die Packungen schreiben dürfen. So gelten etwa feste Grenzwerte, bis zu welchem Fettgehalt Lebensmittel als fettarm bezeichnet werden dürfen. Beim Käse müssen beispielsweise weniger als 3 Gramm Fett pro 100 Gramm enthalten sein.
Beim Müsli wird es aber schon komplizierter: Denn zuckerreduziert bedeutet hier: Im Vergleich zu anderen Lebensmitteln gleicher Art sind 30 Prozent weniger Zucker enthalten. Je nachdem, wie viel Zucker in anderen Müslis steckt, kann dann auch ein zuckerreduziertes Müsli immer noch jede Menge Zucker enthalten und deutlich mehr als reine Haferflocken.
Ähnlich ist es auch mit Light-Produkten: Sie müssen – wenn damit der Kaloriengehalt gemeint ist – 30 Prozent weniger Kalorien enthalten als vergleichbare Lebensmittel. Allerdings ist diese Bezeichnung nicht eindeutig und es muss auch einen Hinweis geben, was genau weniger enthalten ist.
Deshalb lohnt sich immer der Blick ins Kleingedruckte, sprich in die genauen Nährwert-Angaben: Denn dann wird schnell deutlich, dass zum Beispiel eine fettreduzierte Salami insgesamt immer noch mehr Fett enthält als etwa der Schinken. Und möglicherweise steckt im fettreduzierten Joghurt deutlich mehr Zucker als in einem Joghurt mit höherem Fettgehalt [1].
Die Sache mit den relativen und absoluten Werten spielt übrigens, wie wir bereits beschrieben haben, auch bei Nutzenangaben von Arzneimitteln eine Rolle. Mit diesem Quiz kannst du dein Wissen testen.

2. Irgendwie gesünder?
Eine Margarine, die den Cholesterinspiegel senkt – dürfen Hersteller so werben? Eigentlich sind gesundheitsbezogene Aussagen für Lebensmittel nicht erlaubt, es sei denn, sie sind ausdrücklich genehmigt [2]. Ob das so ist, ob also solche Health Claims zulässig sind, prüft die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Die zugelassenen Aussagen werden in einer öffentlich zugänglichen Datenbank gesammelt [3]. Diese Health Claims gelten nicht nur für Margarine, Joghurts oder andere klassische Lebensmittel, sondern auch für Nahrungsergänzungsmittel, die rechtlich ebenfalls als Lebensmittel zählen.
Folgendes über Health Claims ist wichtig zu wissen:
1. Die zugelassenen Aussagen beziehen sich immer auf die Funktion eines gesunden Körpers, nicht auf eine heilende oder vorbeugende Wirkung bei Krankheiten. Solche Aussagen wären nur für Arzneimittel zulässig, die aufwändige klinische Studien und ein umfangreiches Zulassungsverfahren durchlaufen müssen.
Beispiel: Ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C darf mit der Aussage werben „Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei“. Damit ist aber nicht gemeint, dass dich das Mittel vor Erkältung schützt, du seltener krank wirst oder du dich dann nicht mehr mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kannst [2]. Es bedeutet lediglich, dass bei starkem Vitamin-C-Mangel das Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert.
2. Die Hersteller werden manchmal ziemlich kreativ, um die Grenze des Erlaubten auszuloten: So setzen sie etwa bestimmte Inhaltsstoffe zu, um Health Claims möglich zu machen (siehe das Beispiel mit Vitamin und C und dem Immunsystem) – auch wenn das etwa für die auf der Packung groß beworbenen Inhaltsstoffe (zum Beispiel Probiotika) nicht mehr erlaubt ist [4].
3. Für pflanzliche Inhaltsstoffe, die sogenannten Botanicals sind die Bewertungsverfahren zu Health Claims derzeit noch ausgesetzt. Das lässt gewisse Spielräume für die Werbung zu, die aber oft nicht durch wissenschaftliche Studien abgedeckt sind [4].
4. Was bringt ein Vitamin-C-Zusatz in Sachen Gesundheit, wenn ein Produkt total überzuckert ist? Verbraucherschützer fordern seit Langem, dass Health Claims nur bei Produkten zulässig sind, die bestimmte Anforderungen an die Nährwerte erfüllen. Dafür gibt es derzeit aber keine verbindlichen Regelungen [2].
Es lohnt sich also, im Zweifelsfall genau und kritisch hinzuschauen – zumal nicht immer eingehalten wird, was der Gesetzgeber vorschreibt [5].
Spezialfälle
Und dann gibt es auch noch weitere Besonderheiten, zum Beispiel Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke – sogenannte ergänzende bilanzierte Diäten. Sie sehen auf den ersten Blick aus wie Nahrungsergänzungsmittel, also zum Beispiel Kapseln oder Tabletten mit diversen Vitaminen, Mineralstoffen oder ähnlichen Substanzen. Auch sie sind rechtlich keine Arzneimittel, sondern als Lebensmittel für Menschen mit Erkrankungen bestimmt, die ihren speziellen Nährstoffbedarf nicht über die normale Ernährung decken können. So die Theorie. Denn die Angabe einer Krankheit auf dem Etikett heißt nicht, dass alle mit dieser Erkrankung das Präparat brauchen oder bei Einnahme tatsächlich einen gesundheitlichen Vorteil haben.
Diese Produktkategorie eröffnet aber neue Werbemöglichkeiten. Und dabei sind die Grenzen zu Werbung mit arzneimittel-ähnlichen Zuschreibungen manchmal fließend [6]. Das ist selbst für Fachleute nicht immer einfach zu durchschauen. Mit den Health Claims, die für Nahrungsergänzungsmittel zulässig sind, dürfen die ergänzenden bilanzierten Diäten übrigens nicht werben [7].
2. Alles im grünen Bereich?
Du hast die Wahl zwischen 30 Müsli-Sorten und keine Lust, Zucker- und Ballaststoff-Gehalt im Kleingedruckten zu vergleichen? Dann kommt dir die Idee des Nutri-Scores [8] vermutlich entgegen, den du vielleicht schon auf einigen Lebensmittel-Verpackungen gesehen hast. Dort findest du eine farbige Skala mit der Einteilung von A (grün) bis E (rot) – dabei steht grün für eine eher bessere und rot für eine eher schlechtere Nährwertbilanz.
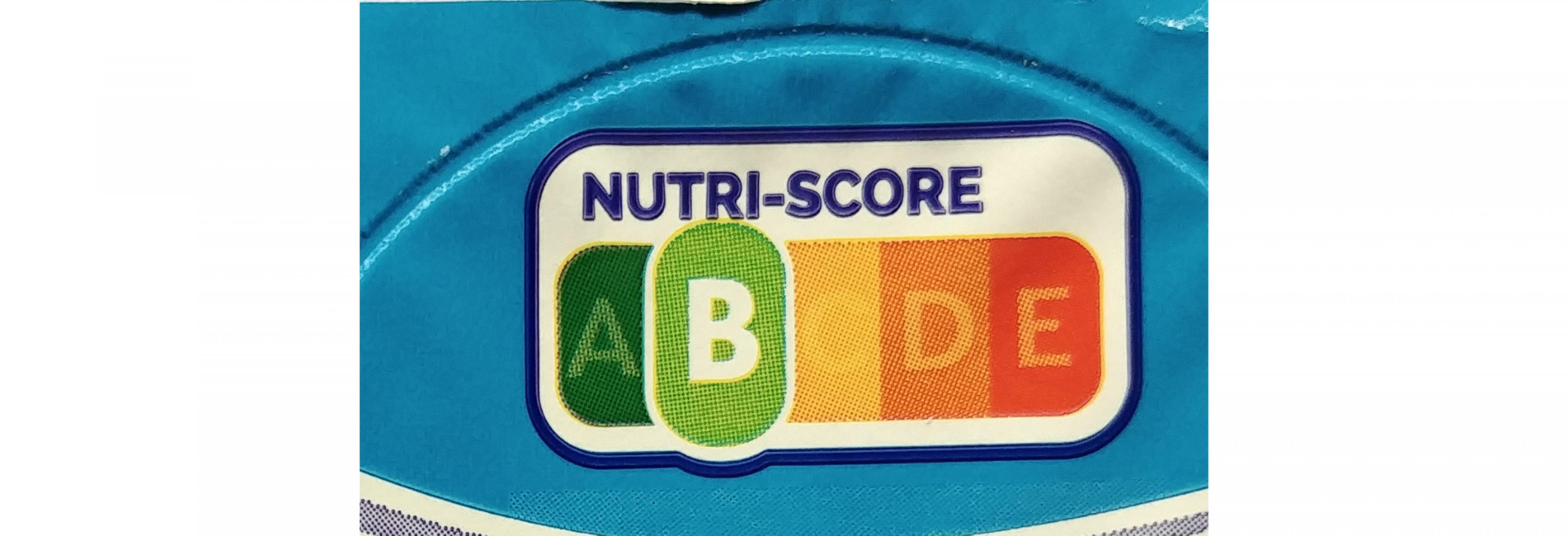
Die Idee dahinter: Gerade bei stark verarbeiteten oder komplex zusammengesetzten Lebensmitteln ist es oft schwierig, schnell zu vergleichen. Für den Nutri-Score werden Punktwerte für eher ungünstige Inhaltsstoffe wie Salz, gesättigte Fettsäuren oder Zucker und für eher günstige Inhaltsstoffe wie Ballaststoffe, Obst und Gemüse miteinander verrechnet. Je nach Summe ergibt sich dann eine der fünf Einstufungen A bis E. Im Idealfall fällt dir damit der Vergleich zwischen den Müsli-Sorten leichter.
Aber natürlich löst der Nutri-Score nicht alle Informationsprobleme: So ist er derzeit noch freiwillig, was den Vergleich manchmal schwierig macht. Außerdem können positive und negative Punkte bei den Inhaltsstoffen verrechnet werden – was Probleme bei einzelnen Inhaltsstoffen möglicherweise verschleiert. Für unverarbeitete Lebensmittel wie Äpfel oder Orangen aus dem Obstregal oder Lebensmittel mit nur einer Zutat (also zum Beispiel die Packung Zucker, die du zum Backen kaufst) ist der Nutri-Score nicht geeignet. Schließlich ist der Nutri-Score auch nicht ausreichend für Faustregeln zur gesunden Ernährung („nur A“ oder „auf keinen Fall E“), denn er bildet nicht vollständig die Anforderungen an eine ausgewogene Ernährungsweise ab.
Zum Weiterlesen
[1] Die Verbraucherzentrale hat eine ausführliche und übersichtliche Zusammenstellung zu den Regelungen für Angaben zu Nährwerten zusammengestellt. In einem weiteren Beitrag findest du noch mehr Details zu weiteren Informationen auf der Packung von Lebensmitteln und zu diversen Siegeln im Lebensmittelbereich.
[2] In diesem lesenswerten Beitrag der Verbraucherzentrale findest du einige grundlegende Hinweise zu Health Claims.
[3] In der EFSA-Datenbank sind zugelassene und abgelehnte Health Claims gespeichert. Dort wird auch zu den wissenschaftlichen Gründen verlinkt, also auf welchen Überlegungen und Daten die Genehmigung oder Ablehnung eines Health Claims beruht.
[4] Ebenfalls lesenswert: Ein Beitrag der Verbraucherzentrale zu Tricks von Herstellern, die Grenzen der Health Claims geschickt auszunutzen – inklusive einer hilfreichen Checkliste, um unseriöse Werbung zu erkennen.
[5] Die Verbraucherzentrale hat 2014 eine Stichprobe von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln überprüft und dabei zahlreiche Verstöße gegen die Regelungen zu Health Claims festgestellt.
[6] Die obersten Bundesbehörden für Regelungen in Sachen Lebensmittel (das Bundesinstitut für Lebensmittel und Verbraucherschutz, BVL) und Arzneimittel (das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM) haben ein gemeinsames Positionspapier herausgegeben, wie die Abgrenzung zwischen Arzneimitteln und Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke geregelt sein sollte. Zuständig für die Kontrolle von Produkten und Werbung sind aber die Behörden der Länder. Und zwischen dem, was im Positionspapier steht, und dem, was sich in den Regalen von Drogerien und Apotheken findet, gibt es teilweise erhebliche Diskrepanzen.
[7] Eine gute Übersicht, wie sich die Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, bilanzierte Diäten und Medizinprodukte inhaltlich und hinsichtlich der zugelassenen Werbung unterscheiden, gibt es bei der Verbraucherzentrale. Ausführlich wird das auch in einem Interview mit einer Abteilungsleiterin aus dem BVL in der Zeitschrift Gute Pillen – Schlechte Pillen thematisiert (€).
[8] Mehr Hintergründe und Details zum Nutri-Score kannst du in einem Beitrag der Verbraucherzentrale nachlesen. Warum mit dem Nutri-Score nicht alles in Butter ist, erklärt Silke Jäger in einem Beitrag bei Krautreporter (€).