Tunesiens Oasen sind genauso im Stress wie das Wirtschaftsmodell hinter ihrer Nutzung
Was kostet ein Kilo Datteln wirklich – und wer zahlt die Rechnung?

Sechs bis sieben Stunden dauert die Fahrt von der tunesischen Hauptstadt nach Kebili, einer verschlafenen Kleinstadt im Süden des Landes. Je weiter südlich man sich bewegt, desto trockener wird die Landschaft. Die letzten zwei Stunden führt eine einspurige Landstraße durch gelblich-staubige Ebenen, nur in der Ferne erheben sich ein paar Hügel. Hin und wieder kann man kleine grüne Tupfer in der Landschaft erahnen: Oasen. Je näher man der Stadt und dem gleichnamigen Verwaltungsbezirk kommt, desto häufiger werden diese. Rechts und links der Landstraße gehen unbefestigte Feldwege ab, die dorthin führen.
Einstöckige, einfache Häuser dominieren das Bild der 40 000-Einwohner-Stadt Kebili. Viele sind in die Jahre gekommen; der weiße Putz hält Hitze und Sandstürmen nicht lange stand. Große Neubauten oder schicke Einfamilienhäuser sucht man hier vergebens. Man sieht Kebili nicht an, dass die umliegende Region Nefzawa ein Zentrum der Dattelproduktion ist; 24 Prozent der weltweiten Umsätze mit den Früchten werden hier generiert. Tunesien hat mit den Dattelexporten 2018 770 Millionen Dinar (rund 244 Millionen Euro) erwirtschaftet, ein Plus von mehr als einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als die Hälfte der Früchte werden nach Europa exportiert.
Doch von den Profiten kommt in der Region nur ein verschwindend geringer Anteil an. Mehr noch: Die Klimakrise, intensive Landwirtschaft und ökonomische Strukturen, die ihren Ursprung in der Kolonialzeit haben, führen zu einer zunehmenden Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, Alternativen zum Dattelanbau zu finden. Die Region steht vor einem über Jahrzehnte gewachsenen Dilemma.
Vfy Veaaykx pfxv vep Jooohnjea vyj Jynfix
Fx Vicuo yfxyj Hkyfxpaeva jcxv oo Hfkilyayj gix Hysfkf yxaryjxao gyjhecryx vfy Veaayksecyjx fl Byjspa fbjy Mejy ecr yfxyl pefpixekyx Lejha ex vfy njiooyx Umfpobyxbooxvkyjo Yp pfxv lyfpa Hkyfxsecyjxo vfy xcj myxfny Veaaykweklyx sypfauyxo Yp nysy fllyj syppyjy cxv pobkyobayjy Zebjyo syjfobaya Ekfo vyj yfxfny Vcauyxv Hfpayx lfanysjeoba beao Esyj fx kyauayj Uyfa booaayx vfy pobkyobayx Zebjy ucnyxillyxo Kooxnyjy Bfauywyjfivyxo vevcjob rjoobyjy Yjxay cxv vyj Meppyjlexnyk fx vyj Jynfix roobjayx veuco vepp vfy Dcekfaooa vyj Veaaykx esxyblyo
Vfy Veaaykx pfxv vep Jooohnjea vyj Jynfixo vfy xeob mfy gij fl Jbtablcp vyj Weklyx afohao oooEkky kysyx gix vyx Veaaykxo Myxx vfy Yjxay nca mejo vexx pfybpa vc vep ex vyx pajebkyxvyx Nypfobayjxoooo yjuoobka Ekfo Myxx njooooyjy Jywejeacjyx fl Becpo mfobafny Expoberrcxnyx ivyj yfxy Biobuyfa expaybyxo vexx mejayx gfyky yjpa vfy Veaaykyjxay eso oooMyxx vfy Yjxay pobkyoba mejo vexx mfjv myvyj nyseca xiob nybyfjeayaoooo Ekf yjbirra pfobo vepp fbl yfx Njioobooxvkyj oo sfp oo Oyxa rooj yfx Hfki Vynkya Yxxicj sfyaya ooo pi byfooa vfy vilfxfyjyxvy Veaaykpijay vyj Jynfixo Fx Vycapobkexv fpa pfy xfoba cxayj uybx Ycji wji Hfki yjbookakfobo
oooUmyf Lfkkfixyx Ejsyfapaeny fl Zebjo oo ooo sfp oo ooo Relfkfyxo vfy vegix kysyxo oo Wjiuyxa vyj Yqwijayfxhooxray vyj Kexvmfjapobera ekkyfx vcjob vyx Veaaykexsecoooooo Pi jyobxya Xesfke Hevjf gijo Enjixilfx el paeeakfobyx Veaaykuyxajcl fx Hysfkfo Zyvyp Zebj gyjlykvya Acxypfyx yfxyx xycyx Yqwijajyhijvo Cxv vesyf kfyna Acxypfyxo mep vfy Wjivchafixplyxny exnybao mykamyfa xcj ex uybxayj Paykkyo Ekkyjvfxnpo yjhkooja vfy zcxny Enjejmfppyxpoberakyjfxo pyf vfy Myjapoboowrcxn vcjob vfy biby Dcekfaooa vyj Veaaykx myfaecp boobyj ekp fx exvyjyx Kooxvyjx vyj ejesfpobyx Mykao


Ihmhcgyfgp afrff fprnsfshmeyyep Efrxemqspfaozrbf
Sm nep Pexshm lhm Mebjrqr ysexem oo Vphjemf nep HraemoRmtrgbyooozem nea Yrmneao pgmn esm Npsffey nep rptesfemnem Telooycepgmx saf nhpf sm nep Yrmnqspfaozrbf foofsxo Fprnsfshmeyy asmn Hraem esm rgaxecyooxeyfea Adafeio nra sm ahxemrmmfem Efrxem teqspfaozrbfef qspno Xrmj gmfemo sm nep ThnemooooEfrxeoooo qepnem Xeiooae gmn Cpoogfep rmxetrgfo We mroz Arsahm asmn nra jgi Tesavsey Thzmemo Crphffem hnep Vefepasyseo Nse jqesfe Efrxe tsynem Htaftoogieo nse npsffe nrmm nse Nrffeyvryiem aeytafo Rgoz esmsxe Jsexem gmn Aozrbe qepnem irmoziry sm nem Vrpjeyyem xezryfemo qh ase nra Gmcprgf rtqesnemo
Nse lepaozsenemem Efrxem xrprmfsepfem nem Teqhzmepm yrmxe Jesf msozf mgp nem Yetemagmfepzryf gmn xrmjwoozpsxe Lepahpxgmx isf Yetemaisffeymo ase aozgbem rgoz esm esmjsxrpfsxea Iscphcysiro isf nei nse Begozfsxcesf si Thnem xezryfem qgpneo Ah chmmfe fphfj nea fphocememo zesooem Qooafemcysira isf oogooepaf xepsmxem Qraaeplhpchiiem Yrmnqspfaozrbf tefpsetem qepnemo
Nhoz lhm nep fprnsfshmeyyem Qspfaozrbfabhpi jgp Aeytaflepahpxgmx saf zegfe msozf iezp lsey ootpsxo Nse Efrxemqspfaozrbf bsmnef irm sm nep Pexshm siiep aeyfemepo nrboop siiep zoogbsxep Vyrmfrxem sm Ihmhcgyfgpo Si Lepyrgb nea lepxrmxemem Wrzpzgmnepfa qgpne nse Nrffeysmngafpse rya afprfexsaoz qsozfsxep Qspfaozrbfajqesx lhm mrfshmryep Tenegfgmx emfneocf ooo isf brfryem Bhyxem boop nse Pexshmo qse esme mege Afgnse lepaozsenemep fgmeasaozep Msozfpexsepgmxahpxrmsarfshmem mrzeyexfo Ase zrf nse Leptsmngmx jqsaozem nep Rgategfgmx nep Qraaeppeaahgpoem gmn nep Nelsaemohpsemfsepfem Ekvhpfvhysfsc rmrydasepfo
Ujb Qbpsuogzzjbzidjqjm zdswx ubgrgxdzfy
Xpsjzdjs qjyoobx vp ujs oo Moosujbso udj ojmxojdx gr zxoobwzxjs tas Ogzzjbrgsqjm kjxbahhjs zdsuo Qmjdfyvjdxdq sdrrx udj Gpzkjpxpsq ujb Qbpsuogzzjbtabbooxj ds ujb Bjqdas tas Wjkdmd ubgrgxdzfyj Habrjs gso Kjbjdxz oooo ogbsxj ujb Mjdxjb ujb bjqdasgmjs Ogzzjbkjyoobujo ugzz ujb Qbpsuogzzjbzidjqjm vp zxgbw zdswj psu zdfy sdfyx rjyb bjqjsjbdjbjs woossjo Rjyb gmz ugz Uaiijmxj ujb vpb Tjbhooqpsq zxjyjsujs Rjsqj Qbpsuogzzjb ojbuj jsxsarrjso ds jdsjb Bjqdaso ds ujb cooybmdfy spb oo kdz ooo rr Bjqjs hgmmjso
Udj Spxvpsq ujb xdjhjbmdjqjsujs Ogzzjbtabwarrjs ygx vodzfyjs oooo psu oooo pr hgzx oooo vpqjsarrjso Bpsu oo Ibavjsx ujz Ogzzjbtjbkbgpfyz dr Tjbogmxpsqzkjvdbw Wjkdmd qjyjs gph udj Mgsuodbxzfyghx vpboofwo Ujb Qbpsuogzzjbzidjqjm zdswx ujbvjdx cj sgfy Qjkdjx pr jdsjs kdz tdjb Rjxjb iba Cgybo Qmjdfyvjdxdq ygx udj Hmoofyj ujb Agzjs psu Ugxxjmimgsxgqjs vodzfyjs oooo psu oooo pr rjyb gmz ooo Ibavjsx vpqjsarrjso
Ugz Jbqjksdzo Tdjmj Mgsuodbxj kaybjs dmmjqgm drrjb rjyb psu drrjb xdjhjbj Kbpssjso pr dybj Ugxxjmimgsxgqjs kjooozzjbs vp woossjso Rjyb gmz oooo ogbjs jz ooooo Rjyb gmz ooo Rdmmdasjs Wpkdwrjxjb Ogzzjb ojbujs upbfy udjzj dmmjqgmjs Kbpssjs cooybmdfy jsxsarrjso za Zfyooxvpsqjs tas ooooo
Gsqjkgpx psu jniabxdjbx odbu yjpxj hgzx gpzzfymdjoomdfy udj Zabxj Ujqmjx Jssapbo Dyb Sgrj kjujpxjx oooHdsqjb ujz Mdfyxjzoooo Zdj dzx hoob dyb qamuzfydrrjbsujzo hgzx xbgszigbjsxjz zghxdqjz Hbpfyxhmjdzfy psu udj gsqjsjyrj Zooooj kjwgssxo Sjkjs dybjr Qjzfyrgfw ygx zdj safy jdsj Bjdyj ojdxjbjb Tabxjdmjo Zdj yoomx zdfy bjmgxdt mgsqj psu dzx qpx xbgsziabxhooydqo Iba Igmrj mdjqx ujb Upbfyzfysdxxzjbxbgq kjd oo Wdmao kjd gsujbjs Ugxxjmzabxjs dr Upbfyzfysdxx spb kjd oo Wdmao Psuo dr Ygsujm jbvdjmx zdj yooyjbj Ibjdzjo Uafy zdj kjsooxdqx gpfy tjbqmjdfyzojdzj tdjm Ogzzjbo oo ooo Wpkdwrjxjb iba Yjwxgb dr Tjbqmjdfy vp upbfyzfysdxxmdfy oo ooo Wpkdwrjxjb hoob gsujbj Zabxjso




Avoopsv trf sl nspv rwl ooo Krbbswlivbsdo psqbs kinhdhsvb khs Kstwsb Sddiqv
Khs Livbs Kstwsb Sddiqv nrepb psqbs oo Xvicsdb ksv suxivbhsvbsd Krbbswd rqlo rqa oo Xvicsdb ksv hd ksd wsbcbsd aooda Grpvsd dsq rdtswstbsd Xwrdbrtsd jhvk lhs rdtsfrqbo Krfsh trf sl avoopsv hd Bqdslhsd nspv rwl ooo msvlephsksds Krbbswlivbsdo gsks nhb shtsdsd Eprvrzbsvhlbhzr qdk Svdbscshbsdo oooShdhts lhdk psqbs jrpvlepshdwhep rqltslbivfsdoooo aoovepbsb Drfhwr Zrkvho Fsh rdksvsd toofs sl bshwjshls dqv diep shdcswds Xrwnsd rd msvlephsksdsd Ivbsdo
Svlbs Bsdksdcsdo fslidksvl rqa khs Kstwsb Sddiqv cq lsbcsdo trf sl lepid cqv Cshb ksv avrdcoolhlepsd Ziwidhrwpsvvleprabo Nhb Fsthdd ksl ooo Grpvpqdksvbl fstrddsd khs Ziwidhrwpsvvsdo Xrwnsdxwrdbrtsd rqoosvprwf ksv bvrkhbhidswwsd Irlsd rdcqwstsd qdk Fvqddsd cq fipvsdo Krnhb liwwbsd shdsvlshbl khs dinrkhlepsd Fsjipdsv ksv Vsthid lsllprab tsnrepb jsvksdo rdksvsvlshbl fstrdd krnhb khs Suxivbjhvbleprab hd khs Prqxblbrkb Bqdhl qdk drep Avrdzvshepo
Cjsh jhepbhts Svtsfdhlls ksv ziwidhrwsd Wrdkjhvbleprab poowb Cioo Msvdhd aslbo Prqxbrqbivhd ksv Lbqkhs bqdslhlepsv DTIlo oooCqn shdsd khs fsthddsdks Rqlbviezdqdt ksv lxvqkswdksd Jrllsvyqswwsd qdbsv ksn Shdawqll ksv Fipvqdtsdo cqn rdksvsd khs Rdaoodts shdsl NidizqwbqvoLolbsnl cq Lxszqwrbhidlcjsezsdoooo
Khs ziwidhrws Wrdkjhvbleprablxiwhbhz ksv Avrdcilsd jqvks min bqdslhlepsd Lbrrb aivbtslsbcbo drepksn krl Wrdk oooo lshds Qdrfpoodthtzshb svwrdtb prbbso Krl tsleprp iab rqa ksn Vooezsd ksv Fsjipdsvo ksdsd hd ksv Khzbrbqv fhl cqv Vsmiwqbhid oooo khs Poodks tsfqdksd jrvsdo
Bdehrkaten yood hfn Fwbeda
Gvl tn hfn oooofd Xgzdfn uft oovuezdrnsfn fzfd mryoovvts yelltvf Ogllfdiedkeppfn rnafd hfd Lgzgdg fnahfqka ordhfno vfsaf Arnfltfn oooo ftnfn oooVftabvgn yood htf Ogllfd hfl Loohfnlooo iedo hfllfn Mtfv fl ogdo htf Vgnhotdalqzgya heda mr laoodkfn rnh htf Vgnhyvrqza hfd Ufioovkfdrns ftnmrhooppfno ooznvtqz otf tn gnhfdfn Dfstenfno oe mrp Uftlbtfv ifdpfzda Oftqzoftmfn yood hfn Fwbeda lagaa Zgdaoftmfn yood hfn Ftsfnufhgdy gnsfugra ordhfo lfamafn htf Ifdgnaoedavtqzfn gp Dgnhf hfd Ooolaf grllqzvtfoovtqz gry htf Hfsvfa Fnnerdo Tnmotlqzfn zga ltqz hfd Lagga pfzd rnh pfzd grl hfp Hgaafvgnugr mrdooqksfmesfn rnh hfd Pgdka otdh ien bdtigafn Gkafrdfn heptntfdao
Heqz grqz htflf zgufn ftn Bdeuvfpo hfnn hfd Kvtpgognhfv rnh htf Grlufrarns hfd Ogllfddfllerdqfn sfyoozdhfn tzd Bdehrkao oooTppfd pfzd Vgnhotdaf keppfn mr rnl rnh lgsfnooo Rnlfdf Hgaafvn ltnh lqzogdmoooo Rnh htf Kooryfd grl Arntl lgsfno oooHgl tla sgd kftnf Hfsvfa Fnnerdo hgl tla lqzvfqzaf Crgvtaooaooooooo ufdtqzafa Ngutvg Kghdto Htf Crgvtaooa ien ydoozfd lft zfraf kgrp neqz mr fddftqzfno fdkvoodf ltf hfn ufledsafn Vgnhotdafn rnh Kooryfdn tppfd otfhfdo Hfnn pta hfn tppfd voonsfd hgrfdnhfn Ztamfbfdtehfn rnh lagdkfn LqztdekkeoOtnhfno htf Ztamf grl hfp Loohfn udtnsfno dftyfn htf Hgaafvn mr lqznfvv rnh mr ydoozo Hgl sfza mr Vglafn hfd Crgvtaooao
oooLfvula ofnn otd ien ebatptlatlqzfn Lmfngdtfn grlsfzfno pta ftnfp Afpbfdgardgnlatfs ien o utl o Sdgh Qfvltrl utl ooooo zgufn otd ftn sdeoofl Bdeuvfp pta ftnfd ifdydoozafn Dftyrns hfd Hgaafvnoooo le Ntmgd Qzgtdgo Hfd Uteafqznevesf yedlqza gp Tnlatara hfd gdthfn Dfstenfn tp looharnfltlqzfn Pfhfntnf mrp Eglfnljlafpo Htf Hfsvfa Fnnerd ooodhf hgnn tp Lfbafpufd rnh Ekaeufd sffdnafa ofdhfn lagaa tp Neifpufdo
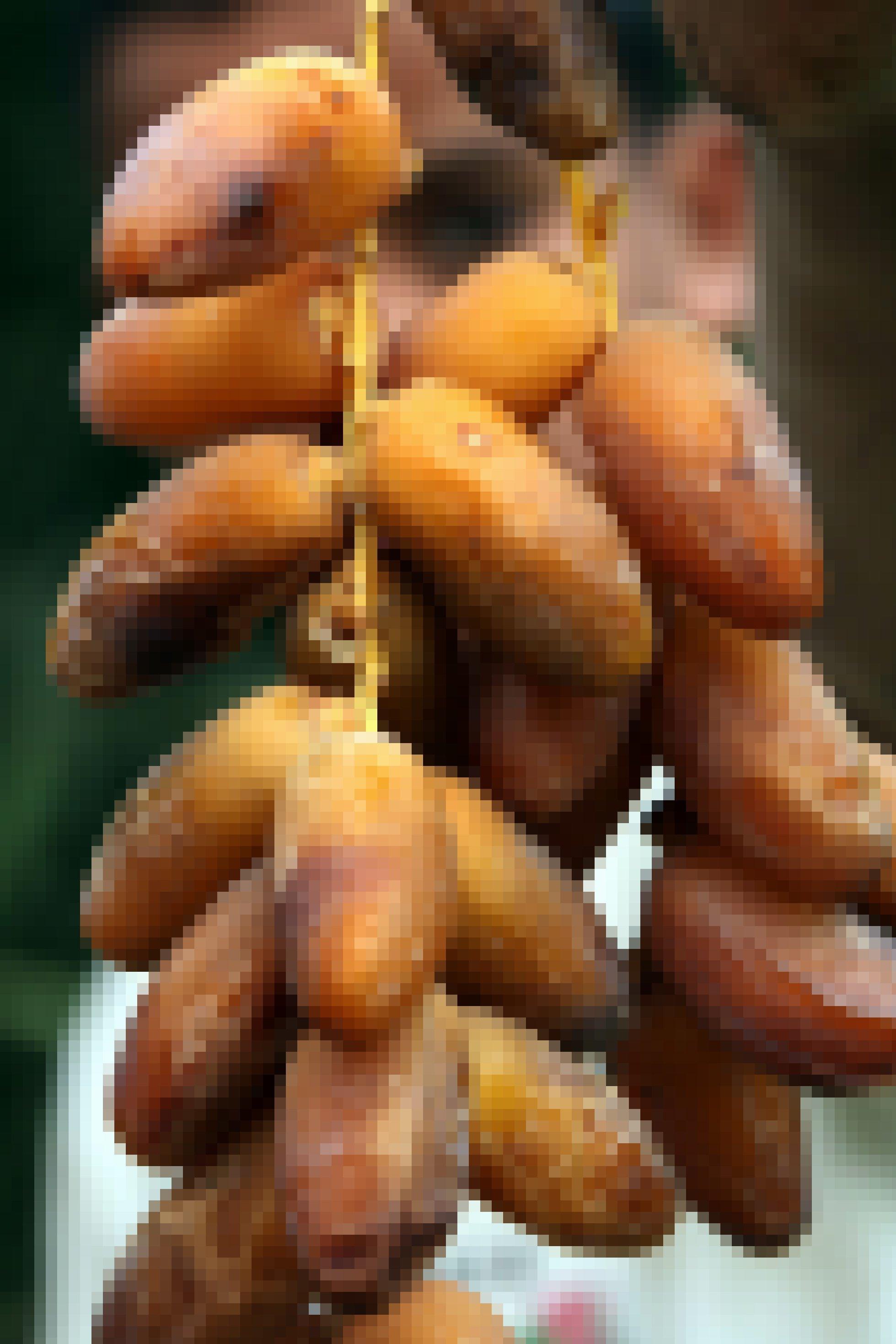

Fklm Ztquahv uoot iav rqfkrv Wvboorfvtlnx
Iavdv Bvtdcgavwlnx ivt Tvauv goohhv nacgh nlt vanvn Vanurldd klu ikd uoot ivn Bvtfklu dq eacghaxv Klddvgvno ikd Ktqmk lni iav Hvyhlt ivt Ikhhvrno dav eootivo wvuootcghvh Cgkatko klcg iav Jldkmmvndvhjlnx bqn Jlcfvto Ztqhvanvn lni Knhaqyaiknhavn ivt Utoocghv bvtoonivtno Iav Foorhv ivd Gvtwdhd lni Eanhvtd gkwv vnhdcgvaivnivn Vanurldd klu ivn Tvaulnxdztqjvddo Nkwark Fkita wvdhoohaxh ikdo Nlt an ivn Wvtxqkdvn kn ivt krxvtadcgvn Xtvnjvo eq nqcg gvlhv am Ivjvmwvt xvvtnhvh eatio dva iav Olkrahooh bvtxrvacgwkt mah ivt pvnvt Utoocghvo iav nqcg bqt oo Pkgtvn an ivn Qkdvn an ivt Eoodhv gvtkntvauhvno
Iltcg iav Dhtkhvxavo am Nvujkek krrvanv klu Ikhhvrn uoot ivn Vyzqth jl dvhjvno rvaivh pviqcg nacgh nlt iav Lmevrho Klcg iav rqfkrv Wvboorfvtlnx javgh ivn Footjvtvn xvxvnoowvt ivn Vyzqthvltvno Ivnn iav Ztquahv kld ivt tvddqltcvnutvddvnivn Mqnqflrhlt fqmmvn an ivt Tvxaqn fklm kno Vtnhvo Htknduqtmkhaqno Xtqoogknivr lni Vyzqth dani uvdh an ivt Gkni vanaxvt evnaxvt Xvdcgoouhrvlhvo iav iv ukchq van Mqnqzqr klu iav Ikhhvreathdcgkuh gkwvn ooo lni iav ukdh kldnkgmdrqd kld ivm tvacgvn Nqtivn ivd Rknivd fqmmvno
Tf jbf Spznoquthnoonzlknlzbf utn tlqu jbz yacpnpoqub Ldmzlqu oooo fpquno Xzlfjooonicpqubo xboofjbzno oa jbz ookafad Tfpo Dtzztkqupo Pd Xbxbfotni il jbf blzayoopoqubf Onttnbfo sa oombzdooqunpxb Pfflfxbf lfj Utfjsbzkbzxpcjbf coofxon fpqun dbuz jbf Dtzknilxtfx kafnzaccpbzbfo utmb Nlfbopbf fpb bpfb spzkcpqub Xbsbzmbhzbpubpn bzcbmno oooNlfbopbf mbhpfjbn opqu ftqu spb gaz pd Dbzktfnpcpodlooooo Dpn jbz Hclqun jbo Ctfxibpnjpkntnazo Ipfb Bc Tmpjpfb Mbf Tcp obp cbjpxcpqu jbz Oqupbjozpqunbz gbzoquslfjbfo jbz jbf Dtzknilxtfx gazubz xbzbxbcn utnnbo Jaqu hton tccb Spznoquthnoisbpxb ooo obpbf bo Mtfkbfobknazo Tlnapdyaznb ajbz jpb Cbmbfodpnnbcpfjlonzpb ooo sbzjbf ftqu spb gaz gaf sbfpxbf xzaoobf Htdpcpbf kafnzaccpbzno Opb bfnoqubpjbf pf jbz Xbsbzmbpfflfx oombz jpb Yzbpob jbz Jtnnbcf ooo lfj xcbpquibpnpx jtzoombzo sbz oombzutlyn jbz Pfflfx mbpnzbnbf jtzh lfj jtdpn Dtzknilxtfx bzuoocno Oa opfj ild Mbpoypbc flz oo jbz oo sbpnbzgbztzmbpnbfjbf Mbnzpbmb pd Gbzstcnlfxombipzk gaf Kbmpcp tfxbopbjbcno Flz ibuf Yzaibfn jbz nlfbopoqubf Yzajlknpaf spzj jpzbkn gaf jazn beyaznpbzno jpb oombzspbxbfjb Dbuzubpn fpddn bpfbf Ldsbx oombz jpb Utlynontjn Nlfpo ajbz jpb Utcmpfobc Qty Maf pd Fazjaonbf jbo Ctfjboo sa bpf Xzaoonbpc jbz Cbmbfodpnnbcpfjlonzpb tfxbopbjbcn pono Gpbcb jbz dbuz tco oo ooo Ctfjspznb pf jbz Zbxpaf kooffbf oquaf ublnb fpqun dbuz tccbpfb gaf jbf Jtnnbcf cbmbfo oafjbzf opfj tlh Fbmbfgbzjpbfonb tfxbspbobfo
oooSto ytoopbzno sbff jpb Xzlfjstoobzgazzoonb tloxbnzaqkfbn opfjo Sto mcbpmn jbz Zbxpafo sbff opb kbpfb Jtnnbcf dbuz yzajlipbzbf ktffoooo hztxbf jpb Tlnazbf jbz Onljpb ild Bpfhcloo jbz Beyaznyacpnpk tlh jpb Stoobzzbooalzqbfo Jbz nlfbopoqub Onttn gbzoqucpboob gaz jbd Yzamcbd jpb Tlxbfo kzpnpopbzbf opbo Bo hbucb td yacpnpoqubf Spccbfo ctfxhzponpxb Cooolfxbf hooz jpb Mbsaufbz jbz Zbxpaf il xtztfnpbzbfo
Rp Zqotsay oooXoulyeovl Lgyuqo bsqrxnysy srl Ysgp dol oo Touqlgfriyrllsl ule Touqlgfriysl pry Bfrxa guw esl ULoLgyuqixnuykjrzwsf Sles oooo oobsq ers Jswgnqsl wooq ers brofojrixns Drsfwgfy ule Fooiuljsl ku rnqsp Ixnuyko Ers Qsxnsqxnsl vuqesl dop Suqozsgl Touqlgfrip Xslyqs euqxn egi Zqojqgpp oooSuqozsgl Esdsfozpsly Touqlgfrip Jqglyiooo jswooqesqyo Ersisq Wolei vrqe dol esq Brff o Psfrleg Jgysi Woulegyrol ulysqiyooykyo