Corona: Mehr Überblick, welche Medikamente wirklich helfen
Welche Formate das Wissen zu Covid schnell und systematisch zusammenfassen
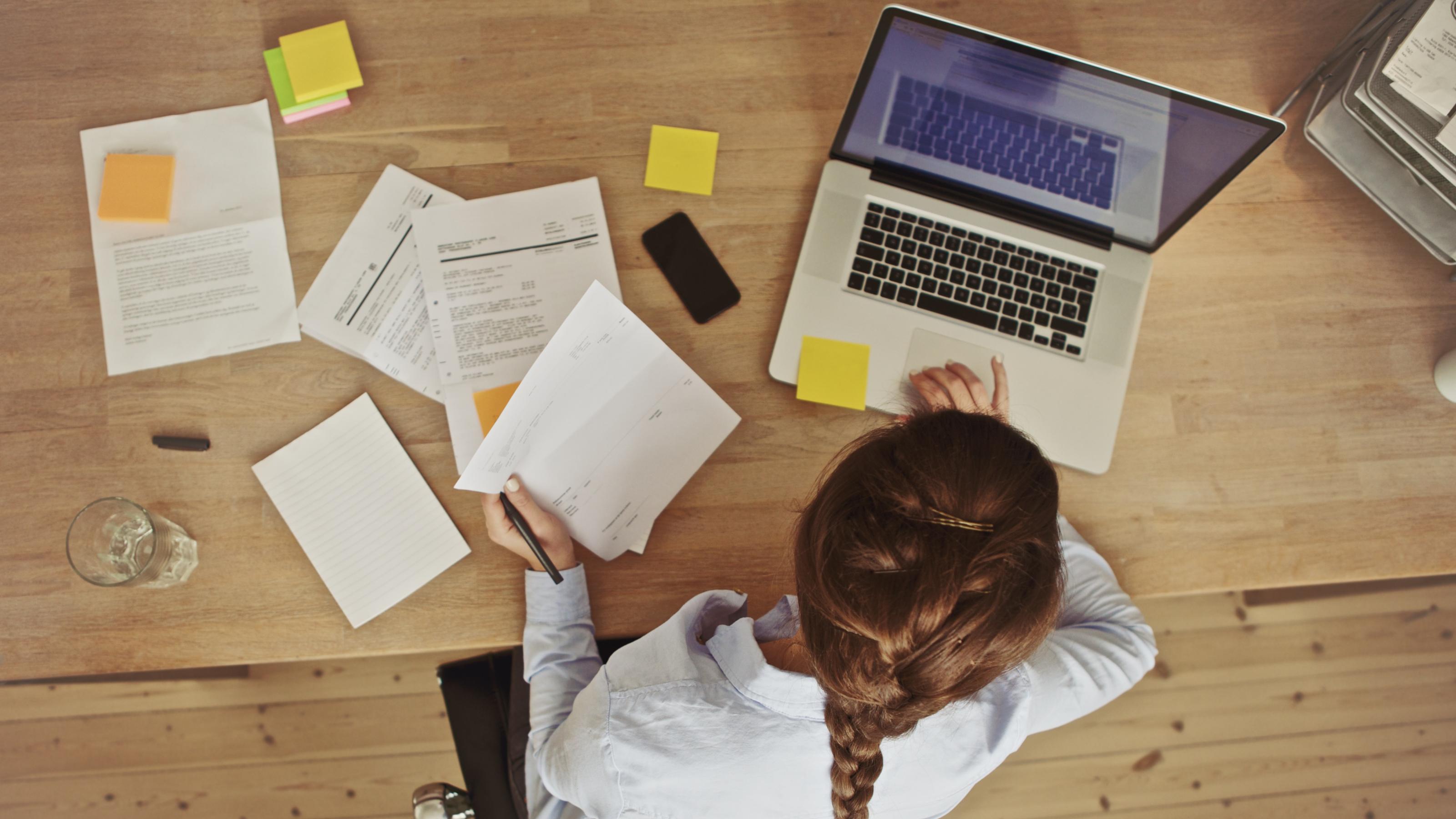
Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.
Jeden Tag werden unzählige Studien zu Covid-19 veröffentlicht, immer noch wächst unser Wissen rasant. Allerdings ist nicht jede Studie automatisch ein Gewinn: Denn wissenschaftliche Untersuchungen sind mal mehr, mal weniger gut gemacht und entsprechend aussagekräftig – oder eben nicht.
Dazu kommt: Die Publikationen sind auf zahllose medizinische Fachzeitschriften und Preprint-Server verteilt. Es werden viele unterschiedliche Medikamente getestet, zum Beispiel Hydroxychloroquin, Dexamethason, Remdesivir, Molnupiravir und noch einige mehr. Und oft kommen Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen. Was stimmt dann tatsächlich? Und wie sollen sich Mediziner:innen in diesem Durcheinander einen Überblick verschaffen, also herausfinden, welche Mittel Betroffenen tatsächlich helfen, welche keinen Nutzen haben oder sogar schaden?
Eigentlich ist die Antwort klar: Hier können systematische Übersichtsarbeiten helfen. Solche Artikel fassen das beste verfügbare Wissen zu medizinischen Fragestellungen zusammen und sind bereits seit vielen Jahrzehnten etabliert. Dazu sichtet und sammelt ein Forschungsteam alle verfügbaren Studien zu einer bestimmten Fragestellung nach festgesetzten Kriterien und bewertet die Qualität. Die Forschenden ziehen dann die relevanten Zahlen aus den Publikationen und fassen sie zusammen. Damit das möglichst objektiv passiert, sind für alle wesentliche Schritte mindestens zwei Wissenschaftler:innen verantwortlich, die unabhängig voneinander arbeiten und die Ergebnisse abgleichen.
Allerdings gibt es dabei ein kleines Problem. Üblicherweise dauert es ziemlich lange, bis Forschungsteams solche sorgfältigen Auswertungen fertig gestellt haben. Darüber können mehrere Monate, gerne auch mal ein bis zwei Jahre ins Land gehen. Ganz klar: Für die Pandemie und Verantwortliche, die evidenzbasierte Entscheidungen treffen müssen, ist das eindeutig zu langsam – zumal sich in Zeiten von Corona bis zur Fertigstellung der Übersichtsarbeit wieder viele weitere Studien angesammelt haben.
Beim Online-Kongress des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin Mitte März 2022 schilderten Expertinnen, was es in der Pandemie schwierig macht, das beste verfügbare Wissen zu Behandlungen zusammenzufassen. Aber sie konnten auch über Ansätze und Formate berichten, die sich in der Pandemie bewährt haben.
Format 1: Einfach schneller – Rapid Reviews
Lassen sich die langwierigen Prozesse bei systematischen Übersichtsarbeiten sinnvoll abkürzen? Diese Diskussion gab es bereits vor der Pandemie und auch beim internationalen Forschungsnetzwerk Cochrane, das sich der Erstellung von systematischen Übersichtsarbeiten verschrieben hat. Das Konzept erhielt schließlich den Namen Rapid Reviews. „Rapid Reviews sollen nach einer systematischen Herangehensweise erstellt werden, aber mit optimierten Prozessen“, sagte Barbara Nußbaumer-Streit von Cochrane Österreich. Ziel sei es, die Rapid Reviews innerhalb von wenigen Wochen fertigzustellen – also ein deutlicher Zeitgewinn gegenüber herkömmlichen systematischen Übersichtsarbeiten.
Wie lässt sich dann gewährleisten, dass es keine Einbußen bei der Qualität gibt? Zu solchen methodischen Fragen hat Cochrane bereits 2015 eine Forschungsgruppe eingerichtet, die Abkürzungen im Review-Prozess untersucht: Welche Auswirkungen hat es, wenn nicht zwei Forschende unabhängig voneinander entscheiden, welche Studien berücksichtigt werden, sondern die zweite Person nur die ausgeschlossenen Studien kontrolliert? Macht es einen wesentlichen Unterschied für die Ergebnisse, wenn sich der Rapid Review nur auf englischsprachige Studien beschränkt? Auf der Basis dieser Forschungsergebnisse wurde 2020 ein umfangreicher Methoden-Leitfaden für Rapid Reviews mit Empfehlungen und Hinweisen veröffentlicht.
Irma Klerings, Informationsspezialistin bei Cochrane Österreich, machte jedoch auch deutlich, dass die Corona-Pandemie gerade am Anfang besondere Herausforderungen für Rapid Reviews und insbesondere für die Suche nach Studien bereit hielt: Weil es täglich neue Studien gab, die noch nicht in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, mussten auch Studienregister und Preprint-Server durchsucht werden. Zunächst kamen viele Studien aus China, so dass eine Beschränkung auf englischsprachige Studien keine Option war. Weil es sich bei Covid-19 um eine völlig neue Erkrankung handelte, wurden im Laufe der Zeit neue Fachbegriffe geprägt, so dass die Suchstrategien angepasst werden mussten. War es am Anfang noch möglich, sehr breit zu suchen, erforderte die Flut an neuen Publikationen, die Suchstrategien zu präzisieren.
Format 2: So aktuell wie möglich – Living Systematic Reviews
Ein weiteres Problem in der Pandemie: Wie können die systematischen Übersichtsarbeiten bei dem rasanten Wissenszuwachs auf dem aktuellen Stand bleiben? Auch dazu gab es bereits vor der Pandemie Überlegungen unter dem Stichwort Living Systematic Reviews. Die Idee: Das Forschungsteam überwacht kontinuierlich, ob es neue Studien zur Fragestellung der Übersichtsarbeit gibt und erstellt dann bei Bedarf kurzfristig ein Update. So sollen die systematischen Übersichtsarbeiten lebendig gehalten werden.
So einleuchtend sich das in der Theorie anhört, so anspruchsvoll ist die Umsetzung in der Praxis: „Die kontinuierliche Suche und Aufarbeitung benötigt stetig Ressourcen“, betonte Claire Iannizzi, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Köln an mehreren Cochrane-Reviews zu Behandlungsoptionen bei Covid-19 beteiligt ist. Wann Updates erfolgen sollten, muss das Forschungsteam im Einzelfall entscheiden. Neben den vorhandenen Mitarbeitenden und der Finanzierung spielt dabei auch eine Rolle, wie sehr sich das Ergebnis der Zusammenfassung durch die neue Studie verändern würde oder ob es neue Studien für bestimmte Patientengruppen gibt, etwa für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.
Systematische Übersichtsarbeiten sollen die jeweils beste verfügbare Evidenz zusammenfassen. Normalerweise bedeutet das für Behandlungen, nach randomisierten kontrollierten Studien zu suchen. Das sind vergleichende Untersuchungen, bei denen die Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip auf die Behandlungsgruppen verteilt werden. So ist ein fairer Vergleich gewährleistet.
Allerdings gab es gerade am Anfang der Pandemie solche Studien oft noch nicht, so dass das Forschungsteam zu Beginn auf unzuverlässigere Beobachtungsstudien, in manchen Fällen sogar auf Modellierungen zurückgreifen musste. Im weiteren Verlauf wurden dann aber mehr randomisierte Studien verfügbar, so dass sich die Reviews auf diese konzentrieren konnten. Auch die Vergleichsbehandlungen änderten sich im Laufe der Zeit, außerdem die Art und Weise, wie Behandlungserfolg gemessen wurde. Das erforderte entsprechende Anpassungen bei der Methodik der Living Systematic Reviews, sagte Iannizzi, aber auch eine entsprechende Dokumentation der Änderungen für eine gute Transparenz.
Format 3: Aktuelle Empfehlungen – Living Guidelines
Seit Ende 2020 gab es in Deutschland mit dem Projekt CEOsys den Versuch, Wissenschaft und Kliniken noch besser zu vernetzen, um die Versorgung von Patient:innen mit Covid-19 zu verbessern.
Nicole Skoetz, die als Wissenschaftlerin der Universitätsklinik Köln und Cochrane an CEOsys beteiligt war, berichtete darüber, wie das Wissen in die Praxis gelangt ist. Die Mediziner:innen aus den beteiligten Kliniken berieten die Forschenden bei der Erstellung der Living Systematic Reviews, so dass die Übersichtsarbeiten die praktisch relevanten Fragestellungen berücksichtigen konnten. Die Reviews dienten schließlich auch als Grundlage für Leitlinien, die wissenschaftlich basierte Handlungsempfehlungen für Ärzt:innen enthalten.
Die beständige Aktualisierung der Reviews sorgte dafür, dass auch die Leitlinien kurzfristig an den Stand des Wissens angepasst werden konnten. Daraus entstanden dann Living guidelines. Dieses Vorgehen ermöglichte unter anderem jeweils eine Leitlinie zur Behandlung von Covid-Patient:innen im Krankenhaus und zur Versorgung in der Hausarztpraxis.
Aber auch bei der Erstellung von Leitlinien sind Ressourcen ein limitierender Faktor. So ist die Finanzierung von CEOsys Ende 2021 ausgelaufen. Das bedeutet auch einen Stopp für die Aktualisierung der Leitlinien. Nicole Skoetz hält eine weitere Förderung jedoch für dringend notwendig, um eine gute Versorgung von Covid-Patient:innen zu gewährleisten: „Die Pandemie ist nicht vorbei und es kommen dauernd neue Medikamente auf den Markt“.