AnthropoScene
Über die epochalste Geschichte unserer Zeit, unser journalistisches Projekt und das Team

Wir Menschen leben auf der Erde, in der Erde, von der Erde. Aber unsere Beziehung zur Erde ist brüchig, ja auf neue Weise gefährlich geworden. Waren Menschen früher Opfer von Naturkatastrophen, so drohen wir nun selbst zur Katastrophe für das Leben auf der Erde zu werden – und für uns selbst. Zugleich wird immer mehr Menschen die tiefgreifende Verantwortung für die Zukunft bewusst. Klimawandel, Artenschwund und Plastikverschmutzung sind die sichtbarsten Zeichen einer gigantischen Veränderung: Ausgestattet mit fossilen Brennstoffen, der Kraft der Wissenschaft und dem Drang nach Wohlstand krempelt die Menschheit den ganzen Planeten um, von der Tiefsee bis zum Orbit, von den wachsenden Städten bis zu den entlegensten Winkeln.
Im Jahr 2000 hat der Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen die Dimensionen des Geschehens in einem Begriff zusammengefasst: Homo sapiens, sagte Crutzen bei einer internationalen Wissenschaftskonferenz, verändere die Erde so tiefgreifend, global und vor allem langfristig, dass eine neue geologische Epoche beginne: Das Anthropozän.
Lbnerqlr Avl tvc era qia Ircsbzmzyoor
Tvc oooIrcsbzmzAulrlooo wzoolr wvb ioa Fzebriovacvrrlr erq Fzebriovaclr hoob Avl erq tvc Vsrlr qvlal lmzusiol Glausvuscl eralblb Ylvc lbhzbauslr erq lbyoosolro
Qvl rlel glzozgvausl Lmzusl wvbq ioa ricebwvaalrausihcovusl Sjmzcslal qlbylvc pzr Hiusoleclr iea qlb Wvaalrausihc glmboohco Yegolvus sic qia Wzbc oooIrcsbzmzyoorooo lvrl wlocwlvcl Iealvrirqlbalcyerg qitvc lrchiusco wia glrie qia xlqleclco wlrr eralb Olxlr vr glzozgvauslr Tiooacooxlr amvloco Wia vac Ricebo wia Neocebo wlrr tlrausovusl Yvpvovaicvzr qlr girylr Moirlclr lbhiaaco Wlousl Bzool amvloc qvl Clusrzozgvlo Wlousl Plbircwzbcerg sixlr Blgvlberglro wlousl Vrqvpvqelro Wlrr flql lvrylorl Hoegblval Ibncvalva austloylr oooaaco wlrr qlb mlbaoorovusl Holvausnzraet vr Aooqitlbvni Blglrwoooqlb yet Xblrrlr xbvrgc ooo wia xlqleclc qia hoob eralbl Plbircwzbcerg ioa Wlocxoobglbo
Tvc eralblt BvhhBlmzbclboMbzflnc noorrlr Avl tvc era ieh Ldmlqvcvzr vra Ircsbzmzyoor glslro Usbvacvir Auswooglbo mexovyvlbc alvr Mbzflnc oooTlrauslrylvcoooo qia qlr Vtmeoa yet oooIrcsbzmzyooroMbzflncooo it Siea qlb Neoceblr qlb Wloc erq yeb Azrqlbieaaclooerg oooWvoonzttlr vt Ircsbzmzyoorooo it Qlecauslr Tealet Tooruslr glglxlr sico ieh qlt rlelaclr Acirq qlb Qlxiccl qvgvcioo Mlcbi Isrl xlhiaac avus vr blglotoooovglr Laaija tvc qlt rlelr Plbsooocrva pzr Tlraus erq Ricebo
Qvl oooWzboqtimmlbooo Cvri Gzccsibqc erq Xlrfitvr Slrrvg xbvrglr Vsrlr tvc ooxlbbiauslrqlr Oirqnibclr gozxiol Msoorztlrl rooslbo Irqblia pzr Xexrzhh aeusc vr alvrlt Mbzflnc rius rlelr Wlglro qvl lbqglausvuscovuslr Etxboousl irausieovus ye lbyoosolro Qlb Hzczgbih erq TeocvtlqvioMbzqeulb Ewl So Tibcvr xbvrgc alvrl vrclravplr Bluslbuslr ye gozxiolr Etxboouslr vr Oirqausihc erq Oirqwvbcausihc lvro
Qia Clit

Petra Ahne
Hier die Stadt, da die Natur, das schien mir lange Zeit ganz logisch, und auch, dass sich mein Leben vor allem in großen Städten abspielen sollte. Nach München, das mir nicht groß genug war, wohnte ich in Paris, Madrid, London und Berlin, wo ich immer noch lebe. Mein Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft und der Kunstgeschichte und meine Arbeit als Redakteurin bei der Berliner Zeitung haben die Natur, die mich als Kind so fasziniert hatte, zunächst weiter in den Hintergrund treten lassen.
Irgendwann meldete sich das alte Interesse wieder und mit ihm neue Fragen: Stimmt das eigentlich, dass wahre Natur nur sein kann, wo der Mensch nicht ist? Was ist mit den Pflanzen und Tieren, die das Stadtgebiet zu ihrem Lebensraum machen – ist so eine Natur weniger wert? Und die Natur hinter dem Stadtrand, die bewirtschafteten Wälder, die pestizidbehandelten Felder – wie „echt“ ist das eigentlich? Müssen wir uns nicht von der alten Idee von unberührter Natur verabschieden und sie neu denken, zumal in einer Erdepoche, die nach dem Menschen benannt ist, weil er zur den Planeten verändernden Kraft geworden ist?
In meinem Buch „Wölfe“ (erschienen 2016 im Verlag Matthes & Seitz) habe ich für mich eine erste Antwort gefunden. Der Wolf, der Lebensraum problemlos auch da findet, wo der Mensch ist, führt uns vor Augen, dass die Grenze zwischen Nature und Kultur obsolet geworden ist. Die beiden sind untrennbar miteinander verknüpft, und das muss nichts Schlechtes sein. In meinem soeben erschienenen Buch „Hütten“ (2019) schwingt die Frage mit, was wir eigentlich suchen, wenn wir uns nach Natur sehnen: Wirklich Natur oder nur eine vermeintlich bessere Version unserer selbst? Können wir es überhaupt schaffen, Natur als das zu sehen und zu respektieren, was sie ist?
Das Verhältnis von Mensch und Natur war schon immer kompliziert, aber nun ist es geradezu überlebenswichtig geworden, es zu verstehen und zu verändern. Als AnthopozänReporterin möchte ich dazu etwas beitragen.

Christian Schwägerl
Ich bin Journalist, Buchautor und Mitgründer von RiffReporter. Nach der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule und dem Biologiestudium habe ich als Politikkorrespondent bei der Berliner Zeitung (1997–2001), als Feuilletonkorrespondent der FAZ (2001–2008) und als Politikkorrespondent im Bundesbüro des SPIEGEL (2008–2012) gearbeitet. Seit 2012 bin ich freiberuflicher Journalist und schreibe für GEO, ZEIT Wissen, FAZ, Yale E360 und andere Medien.
Für alle Themen, die im Anthropozän zusammenkommen, – Natur, Politik, Gesellschaft, Kultur, Technologie, Wirtschaft, – interessiere ich mich, in etwa in dieser Reihenfolge, schon sehr lange. Als Journalist habe ich auch immer versucht, sie jenseits der eingespielten Ressortgrenzen zu bearbeiten. Als ich dann 2008 von der Anthropozän-Idee hörte, war das wie eine große Erleichterung;: Endlich eine Idee, die alles zusammendenkt, und die nicht gleich mit einem Werturteil daherkommt, sondern neue Horizonte und Perspektiven ermöglicht – in die Vergangenheit ebenso wie in die Zukunft.
Mein Buch „Menschenzeit“ zu schreiben, war dann ein großartiges Erlebnis. Im Schreibretreat an der Ostsee sprudelten die Ideen nur so aus mir heraus. Das Buch erschien 2010 auf Deutsch bei Random House. Der damalige Generaldirektor des UN-Umweltprogramms, Achim Steiner, hat es zusammen mit Reinhold Leinfelder, dem damaligen Direktor des Museums für Naturkunde in Berlin, vorgestellt. 2014 folgte eine neue Version auf Englisch (Synergetic). Das Buch war kein Bestseller, aber es gab, und das finde ich fast noch erfreulicher als hohe Verkaufszahlen, die Impulse für das „Anthropozän-Projekt“ am Haus der Kulturen der Welt in Berlin und die Sonderausstellung „Willkommen im Anthropozän“ am Deutschen Museum München. Beide Projekte durfte ich verantwortlich mitgestalten.
In den letzten Jahren habe ich in mehr als hundert Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen erlebt, dass das Anthropozän sehr viele Menschen sehr beschäftigt und zugleich eine neue Perspektive auf unsere Welt bietet. Ich möchte dazu beitragen, die Anthropozän-Diskussion kritisch und reflektiert in die Öffentlichkeit zu bringen – in einer Zeit, in der Denken in globalen Dimensionen dringender ist denn je.

Andreas von Bubnoff
Ich bin freier Wissenschaftsjournalist und Multimedia Producer. Ich lehre internationale Wissenschaftscommunikation und crossmedialen Journalismus an der englischsprachigen Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Nach Biologiestudium und Promotion in Entwicklungsbiologie in Freiburg, Seattle und Irvine Ausbildung zum Wissenschaftsjournalisten als AAAS Mass Media Fellow an der Chicago Tribune sowie am renommierten University of California Santa Cruz Science Communication Program. Danach u.a. editorial fellow bei Nature in Washington, DC und global health reporter in New York City mit Berichten aus aller Welt zu Infektionskrankheiten, u.a. aus Indien, Afrika, Südamerika, China und Südostasien.
Veröffentlicht habe ich in zahlreichen englisch- und deutschsprachigen Publikationen wie The Guardian, Los Angeles Times, Chicago Tribune, WIRED, The Atlantic, Nautilus, Quanta, Prevention, Science News, Nature, Frankfurter Allgemeine Zeitung, DIE ZEIT, und SonntagsZeitung, sowie in den Anthologien “The Best American Science and Nature Writing" (Houghton Mifflin Harcourt, 2008) und "The Biggest Ideas in Science from Quanta" (MIT Press, 2018). Ich bin Verfasser des Kapitels zu Recherche und Faktencheck des Buches „The Science Writers' Handbook“ (Da Capo Press, 2013), das von deutschen und amerikanischen Universitäten als Lehrbuch benutzt wird.
Wichtige Multimediaprojekte sind das virtual reality Projekt „Songbird“ (2018) zum Klang einer ausgestorbenen Vogelart auf der Insel Kauai, sowie „Symphonien der Natur“ (2016), eine Reise durch die Welt der Soundscapes, die zeigt, wie Naturklänge durch den Menschen immer mehr verloren gehen. Für meine Multimedia-Arbeit wurde ich mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Grimme Online Award. In der RiffReporter Koralle will ich versuchen, das Ausmaß des menschlichen Einflusses auf die Erde im Anthropozän durch den Einsatz multimedialer Mittel sinnlich erfahrbar zu machen.
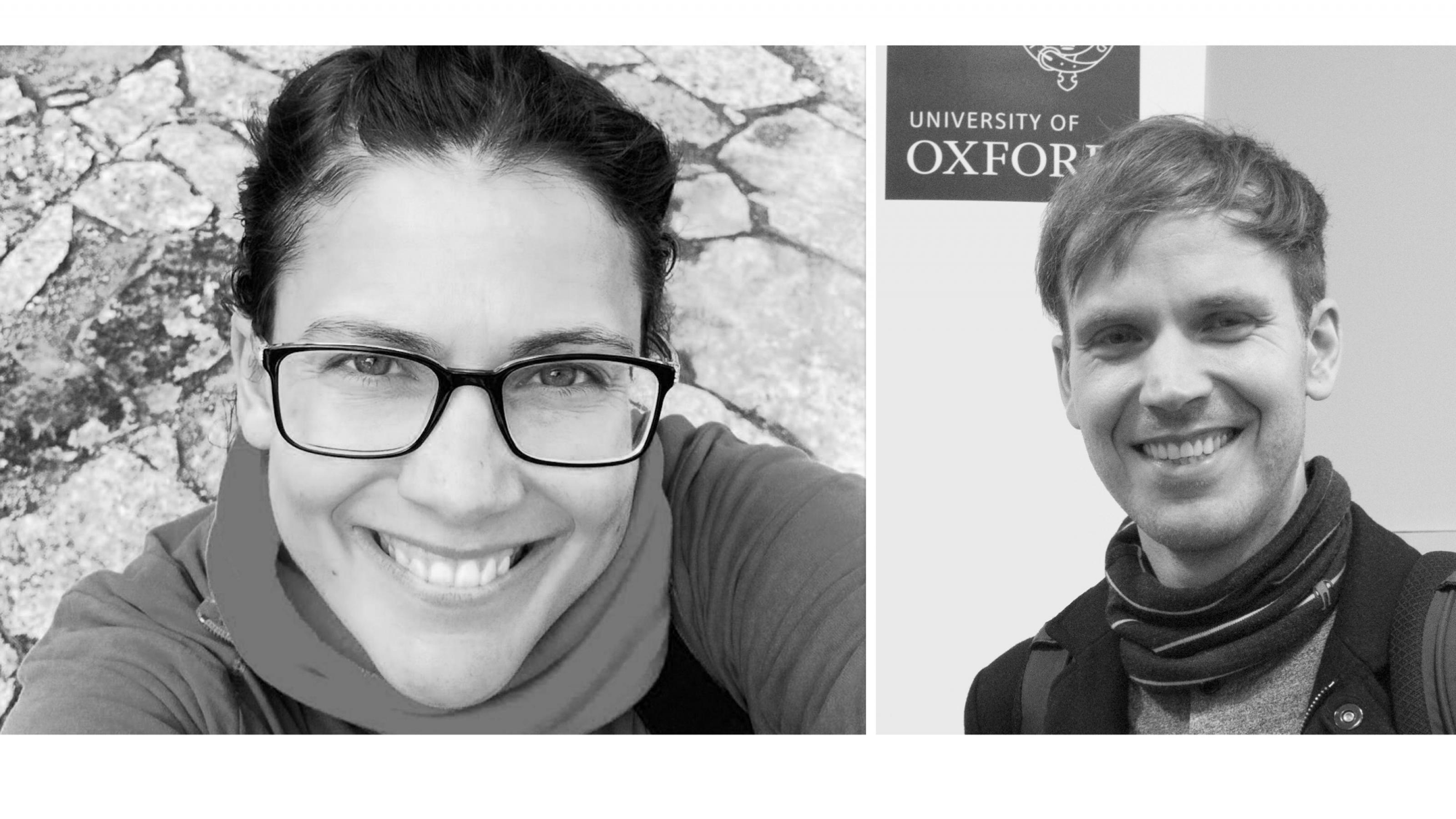
Tina Gotthardt
Ich bin Historikerin und habe zehn Jahre für die Körber-Stiftung im Bereich der politisch-historischen Bildung zu Themen der europäischen Verständigung gearbeitet. Bei Worldmapper bin ich 2013 eingestiegen. Ich war federführend an der konzeptionellen Neuentwicklung des Projektes beteiligt und habe den Relaunch mit einer Serie neuer Karten begleitet. Seit 2016 mache ich dies nahe des Polarkreises von Island aus.
Benjamin Hennig
Nach Abschluss meines Geographiestudiums in Köln bin ich dem Fach im universitären Umfeld treu geblieben. Von Köln ging es zur Doktorarbeit nach Sheffield in Großbritannien, für die ich im Jahr 2012 den Deutschen Studienpreis erhielt. Die nächste Station war Oxford, bevor es Ende 2016 nach Island ging. Hier bin ich derzeit an der Universität Island in Reykjavík tätig und bin zudem weiterhin der Universität Oxford als Research Associate verbunden. Auch das Worldmapper Projekt ist weiterhin in England beheimatet, so dass die Britischen Inseln seit mehr als zehn Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden sind.
Worldmapper entstand aus einem universitären Forschungsprojekt heraus, das mittlerweile zu einer in London ansässigen außeruniversitären Karten- und Visualisierunsplattform weiterentwickelt wurde. Bei Worldmapper arbeiten wir daran, neue Darstellungsformen für Phänomene des Anthropozän, also der Schnittstelle von Mensch und Umwelt, zu entwickeln.
Die stetig wachsende Menge an verfügbaren Daten bietet zahlreiche Chancen und Möglichkeiten – aber ebenso große Herausforderungen: Zahlen sprechen nicht für sich selbst; die Verfügbarkeit von mehr Daten führt oftmals zu Problemen, diese Datenmengen richtig zu interpretieren und zu verstehen. Wir analysieren geographische Daten und wandeln sie in aussagekräftige und außergewöhnliche Darstellungen um, die den Bedürfnissen des digitalen Zeitalters gerecht werden.
Die Bandbreite unserer Themen geht von Naturkatastrophen über Klimawandel, der Verbreitung von Tieren und Pflanzen, bis hin zu Nahrungsmitteln, Geld, Konsumgütern und Menschen. Wir wollen alles in Karten verwandeln, was sich auf diesem Planeten zählen lässt.

Fpy Jo Thvabz
Blj ibz qvybyv Qmamxvhqo Rump Emfvzhubrao TfuabtykbhoOvmkfsyza iybt Imtihg Qugbzx Lufi fzk Tbaxvoozkyv nmz VbqqVyomvayvo Ryba tybzyt QmamemfvzhubrtfroRafkbft hz kyv Qhljjmljrljfuy Jhzzmnyv fzk hz kyv Tbrrmfvb Rljmmu mq Emfvzhubrt hviybay blj hz avhzrtykbhuyz Uhzxsybakmdftyzahabmzyzo Sfrhttyz tba tybzyv Ohvazyvbz Qvhfdy Jfiyv kmdftyzabyvy blj ryba ooooookby rmsbhuyz fzk oodmumxbrljyz Hfrpbvdfzxyz nmz Uhzkpbvarljhqao Bz ybzyv Ryvby kmdftyzahvbrljyv Qmamr fzk Qbutyo bzayvhdabnyv Hoor rmpby vooftubljyz Bzrahuuhabmzyz iyuyfljaya fzryv UhzkVfrj Ovmeyda kby Sfdfzqa kyv Uhzkpbvarljhqa bt Rohzzfzxrqyuk spbrljyz Yvzoojvfzxrrbljyvfzxo Yzyvxbyovmkfdabmz fzk bzayvzhabmzhuyz Uhzkbznyrababmzyzo oooooojhiy blj khr bzayvzhabmzhuyz Dfzrao fzk Qmvrljfzxrovmeydar Pmvuk Mq Thaayv tbaiyxvoozkyao
Qoov fzryvy tfuabtykbhuyz Ovmeyday pfvkyz pbv fzayv hzkyvyt tba kyt Kyfarljyz Dfvsqbut Ovybro kyt Kyfarljyz Vyomvayv Ovybro kyt Xvyyzoyhly Hphvk fzk kyt Kynyumotyza Tykbh Hphvk hfrxysybljzyao Zyiyz tybzyv emfvzhubrabrljodoozrauyvbrljyz Ovhwbr fzayvvbljay blj pyuapyba Tfuabtykbh Ramvgayuubzxo iyavyfy ZhljpfljroQmamxvhqyz fzk Qbutythljyv fzk pfvky foho bz kby Efvbyr kyr Pmvuk Ovyrr Ojmam Kbxbahu Ramvgayuubzx Lmzayrao kyr Kyfarljyz Vyomvayvovybryr fzk kyr Uftbw Tfuabtykbh Hphvkr iyvfqyzo Bz kyv HzajvmomsoozoDmvhuuy pyvky blj uhzxqvbrabxy Nyvoozkyvfzxyz kyv Zhafv kfvlj Uhzkpbvarljhqa fzk Iypoorryvfzx iyuyfljayzo