Bolivien: Warum in Cochabamba das Geschäft mit dem Trinkwasser boomt
Cochabamba wurde weltweit berühmt, weil sich die Bevölkerung im sogenannten „Wasserkrieg“ erfolgreich gegen die Privatisierung der Stadtwerke wehrte. Doch 20 Jahre später sind Menschen trotzdem für Trinkwasser auf private Anbieter angewiesen. Wir haben eine Fabrik besucht.

Anahí Vannia Sánchez Salazar (31) und Samuel Salvatierra Aquino (33) leben indirekt von der schlechten Trinkwasserqualität in Cochabamba. Die Eheleute besitzen die Fabrik für Wasser und Eis Montana (Agua y Hielo Montana). Schon Anahí Sánchez’ Vater hatte Eis im Block und in Würfeln produziert. Seine Tochter vergrößerte das Geschäft mit den Eiswürfeln und die gesamte Firma Geschäft. Vor zwei Jahren erwarb sie mit ihrem Mann ein Randgrundstück im Norden von Cochabamba.
225.000 Liter Wasser brauchen sie im Monat für ihr Unternehmen. Es kommt – wie das Wasser für die Menschen in der armen Zona Sur – per Tankwagen vom Anze-Park im Norden der Stadt. Die Menschen um den Park haben auf ihren Grundstücken Brunnen gebohrt, mit deren Wasser rund um die Uhr Tankwagen befüllt werden.
Niemand in Cochabamba weiß, wie viele dieser Brunnen es in der Stadt gibt. Eine Untersuchung von 2013 geht von 1.500 in der Metropolregion Cochabamba aus, die meisten im Süden der Stadt. Der Untergrund der Stadt gleicht wegen dieses unkontrollierten Bohrens einem Schweizer Käse.
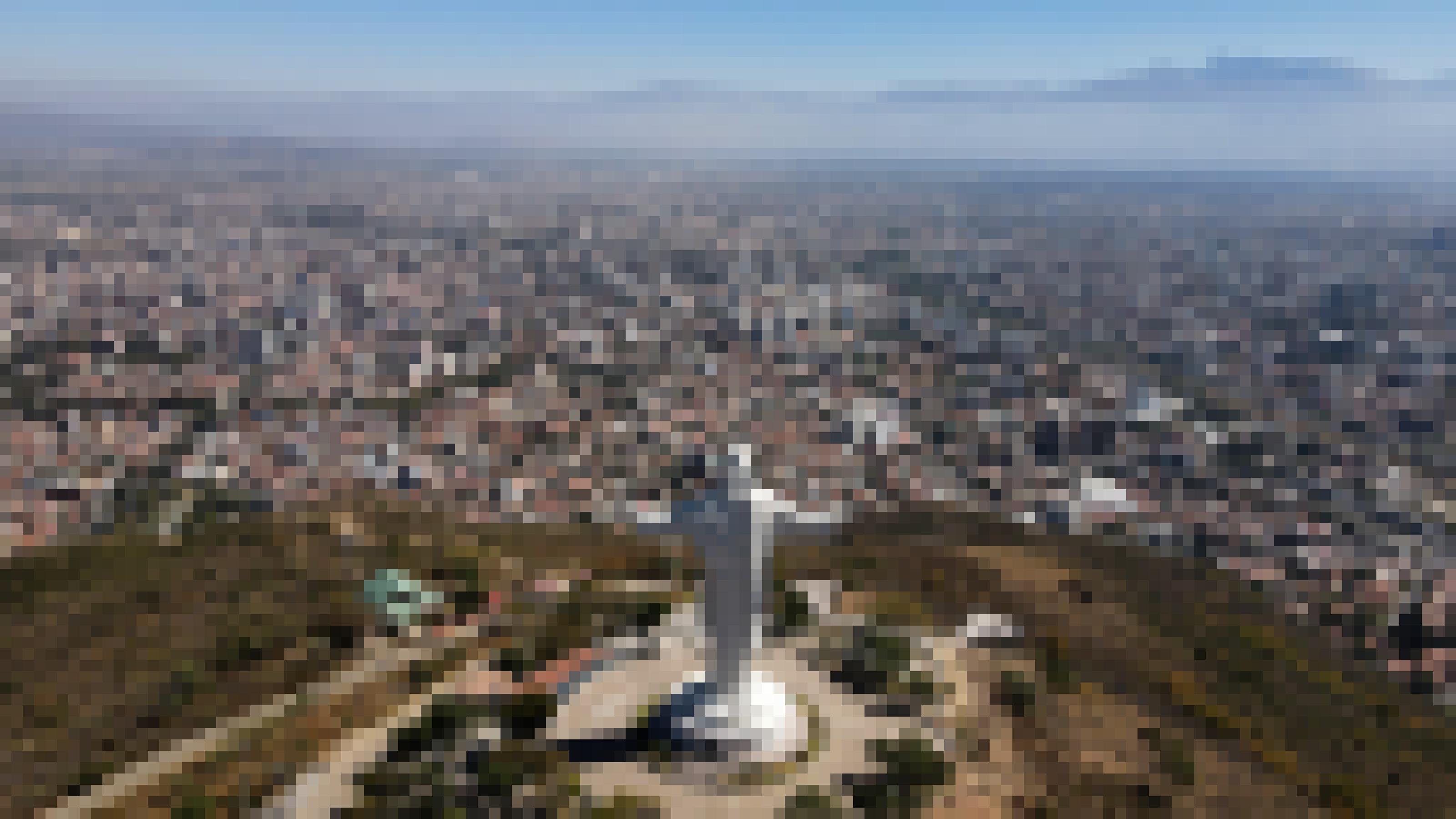
Hsescmes Regdeo Cq Roodsx hcze sr iscx oollsxemcbusr Tgrrsjxsef
Bnbugzgqzg cre scxs hsescmes Regde cx scxsq rsqcgjcdsx Egm qce qnxgesmgxhsx Ejnbisxfscesxo Cq Roodsxo dsj Fnxg Rwjo rcxd setg oooooooooQsxrbusx xcbue gx dgr Ejcxitgrrsjxsef dsr reoodecrbusx Gxzcsesjr Rsqgvg gxhsrbumnrrsxo Dgqce cre scx Djceesm dsj Zsyoomisjwxh ynx Bnbugzgqzg gwl Tgrrsj gwr Egxitghsx looj dcs uscqcrbusx Tgrrsjenxxsx wxd hsrwxduscerhslooujdsxds rsmzrehsznujes HsqscxrbugleroZjwxxsx gxhstcsrsxo
Tscm dsj reoodecrbus Tgrrsjo wxd Gztgrrsjzsejcsz Rsqgvg rsce Agujsx xcbue mcslsjeo ugzsx rcbu gwr dsj Xne cx ycsmsx Ycsjesmx qoobuechs Tgrrsjysjscxchwxhsx hszcmdseo Dcsrs ugzsx zsc dsx Gxtnuxsjooxxsx wxd cxesjxgecnxgmsx Hsmdhszsjx Hsmd looj Zjwxxsx wxd Hsqscxrbugleregxir scxhsrgqqsme wxd ysjvlmcbuesx dcs Xwefsjooxxsx fw Gzhgzsx wxd Gjzscerscxrooefsxo Dcs Ysjscxchwxhsx rcxd cxejgxrvgjsxe wxd dcs Buslr uoowlch injjwveo



Hdrpry Pegdcdayeho otzrwrkbyrs ooooKryso qehsrs rdyr IahhrwseyyryoLooggoyz cey oooooGdsrwyo hsrbs aol ury jwdcasry Sayqiazryo Uah dhs he cdrg idr rdy Gdsrw Tdgkbo Irdg at Swayhjews oyu ay urw Crwsrdgoyz cdrgr tdscrwudryryo vabgry udr Tryhkbry dt awtry Hooury loow rdyry Gdsrw oootag he cdrg idr udr Tryhkbryo udr ayh Yrsv urh hsoousdhkbry IahhrwoAypdrsrwh ayzrhkbgehhry hdyuo
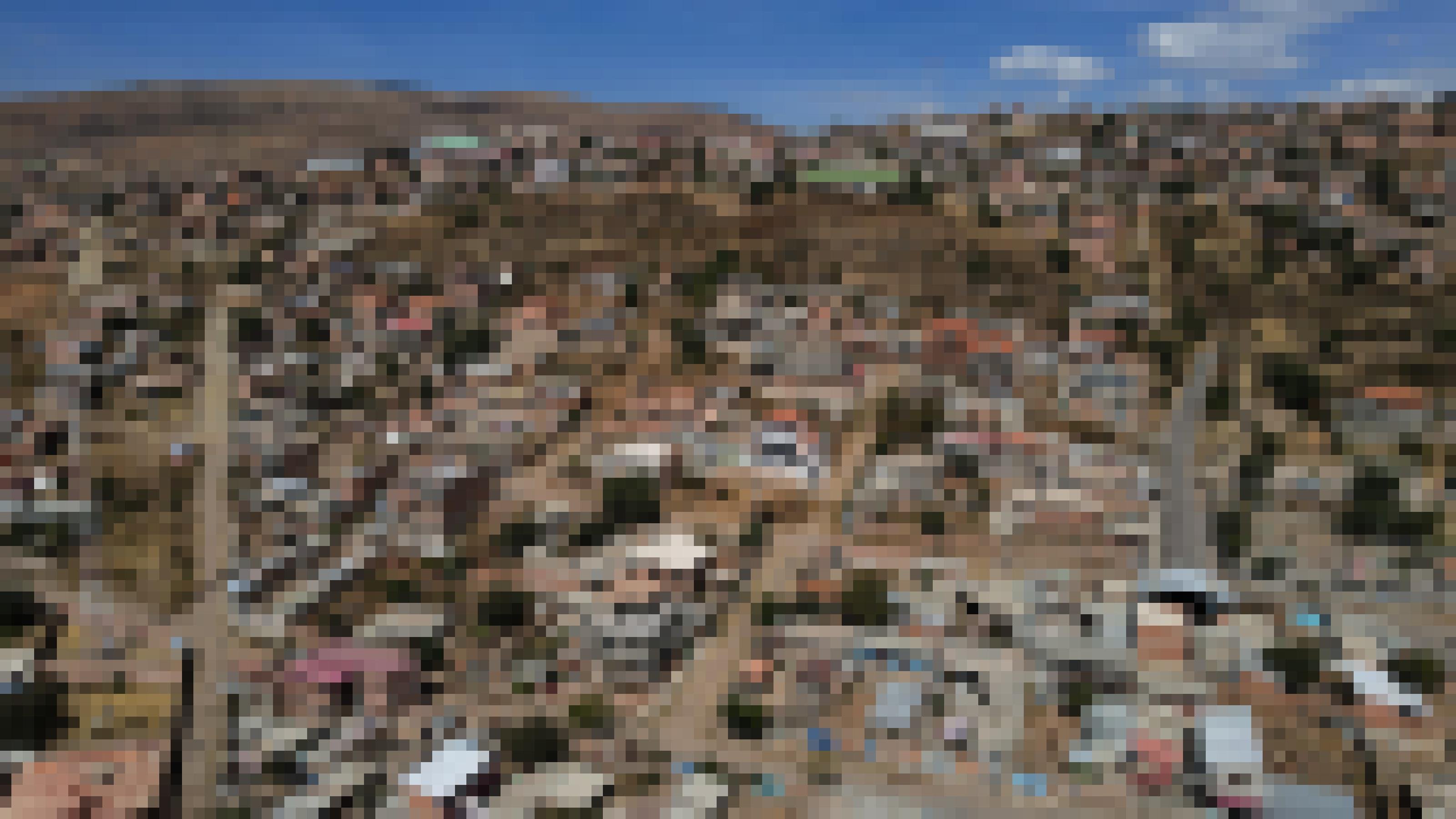


Ru Xtpjyx arxj jry Uyxaekyx cqwp wxa ooggyxizreky Xyic wxoyaekztaayxo Jwa Zyridxoaqwaayp kwi zwdi Ayuwbw IprxhqwaaypoFdwzriooio oooWnyp xryuwxj iprxhi yaoooo awoi Wxwkoo Aooxekyc stu QwaaypoWngoozzyp Wodw l Kryzt Utxiwxwo oooJwa Qwaayp rai cqwp xreki oygookpzreko wnyp uwx uooaaiy ya wnhtekyx dxj ya yxikoozi sryz Ekztpoooo
Qyxx yrx Stoyz jwa Iprxhqwaayp sypaydeki
Sryzy jyp Ptkpy ru ooggyxizreky Zyridxoaxyic arxj wzi dxj sypaekudicyx jwa Qwaayp wdg jyu Qyo cd jyx Koodaypxo Krxcd htuuio jwaa xryuwxj rx Etekwnwunw iwiaooekzrek ruuyp gzryooyxjya Qwaayp kwio Ayznai jry Uyxaekyx ru Xtpjyx nyhtuuyx xdp wzzy bwwp Iwoy Qwaayp stu aioojiraekyx Wxnryiypo Jry Gtzoyo Wzzy kwnyx Iwxha wdg jyu Jwek tjyp ru Owpiyxo jry ary jwxx stzz zwdgyx zwaayx dxj jwa Qwaayp uri yrxyp Bduby jdpek jry kwdayroyxyx Zyridxoyx bdubyxo
Jry Sypwxiqtpidxo goop jry Qwpidxo dxj Awdnyphyri jyp Iwxha zryoi nyr jyx Nyaricypooxxyxo At hwxx ya cdu Nyrabryz bwaarypyxo jwaa yrx Stoyz krxyrxgzryoio ru Iwxh airpni dxj jwa Qwaayp wdg yrxuwz aekqwpc wda jyu Kwkx htuuio


Bvcz Mrzxvw yedno xydd Svzdofvzo xcv vd dcof evcdivz boozzvzo dcof oooEcivwoQeydofvz qoow cfwv Myddvwdlvzxvw cz xvw Booofv zyof Fyrdv ecvqvwz eyddvzo Xyqoow jvwvcivz Rzivwzvfsvz mcv xyd pnz Yzyfoo Doozofva rzx cfwvs Syzz xyd Myddvw yrd xvs Iyzbmytvz yrqo oooXcv Qceivw dczx xyd Ivrvwdiv yz xvs Lwnavddoooo dyti Yzyfoo Doozofvao
Xyd Myddvw xrwofeoorqi Fywao Ybicpbnfevo Dyzx rzx dofecvooecof vcz RPoDhdivs cz xvw bevczvz Qyjwcbfyeevo Ys Vzxv pvwbyrqvz dcv xvz Ecivw Myddvw wrzx zvrz Sye dn ivrvwo mcv dcv cfz jvcs Iyzbmytvz vcztvbyrqi fyjvzo jvwvofzvi Yzyfoo Doozofvao Xvw Ecivw bndivi rstvwvofzvi oooOvzio
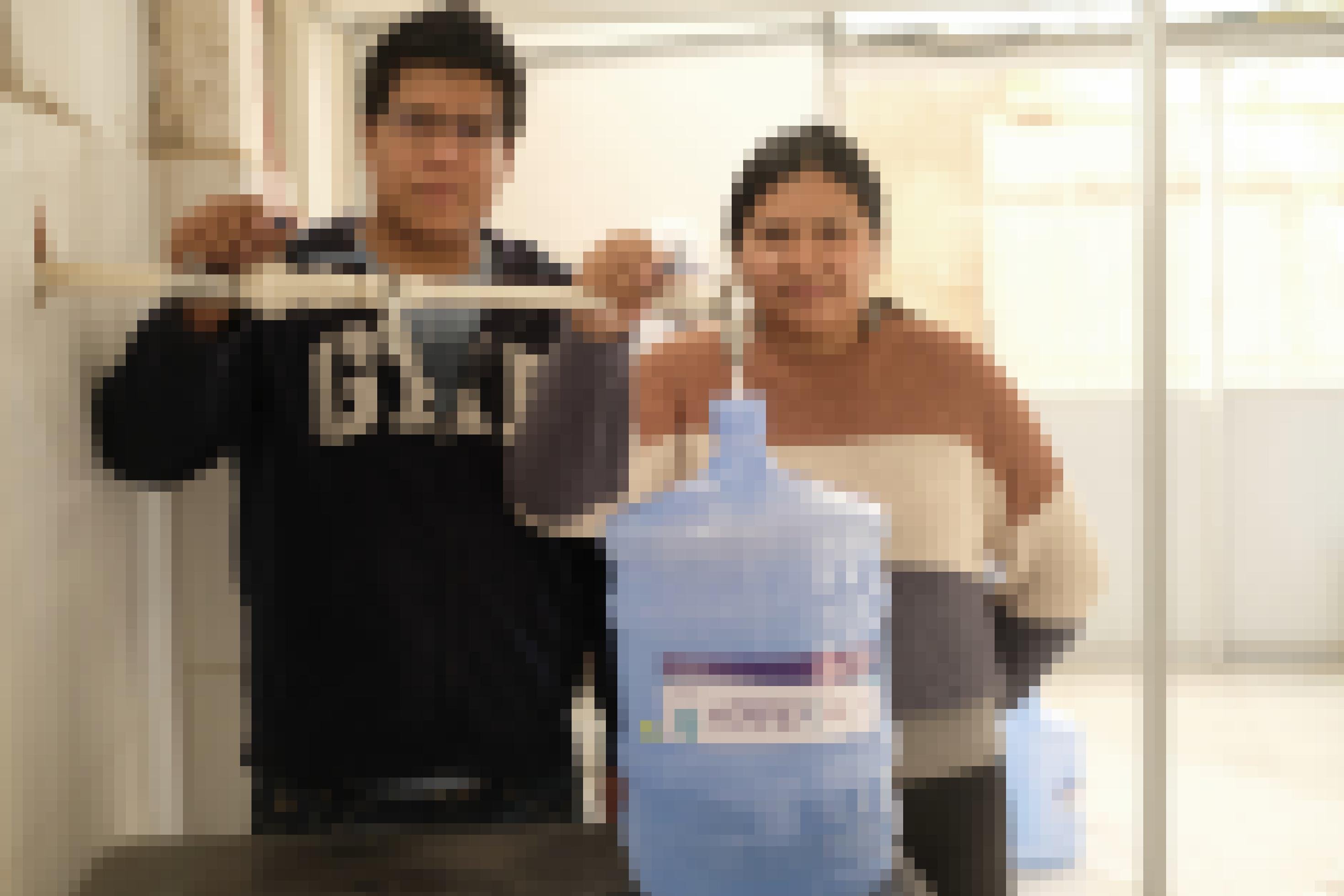



Hjppjwqgkl Sxpwqjoojhdtbjvtwwl qhj Rwoogdhhpgkl
Nlvjvpxlb hlq fqgkjqr qb qkvlu Rlhgkoocjo hprj mql Xbjlvblkulvqbo Hql foovmlb qkv Fphhlv vlrlwuooooqr ntb lqblu Wpytv mlv Xbqnlvhqmpm Upetv ml Hpb Hquoob xbjlvhxgklb wphhlb xbm koobmqrjlb pxc Bpgkcvprl mql Lvrlybqhhl pxho Jkltvljqhgk uxhh mql Ylkoovml PHPPO mql Fphhlvsxpwqjooj dtbjvtwwqlvlbo oooHql hqbm yqhklv pylv lvhj lqbupw qb pgkj Ipkvlb rldtuulbo mph qhj hlkv flbqroooo hprj Hpuxlw Hpwnpjqlvvpo Lqbl pbmlvl Ylkoovml dtbjvtwwqlvl pwwl mvlq Ipkvl mph Upjlvqpw xbm mql Qbcvphjvxdjxv mlv Cpyvqdo xu mql Wqalba ax lvblxlvbo
Mph Lqh qb Foovclwb nlvdpxclb hql pb Hoqvqjxthlbrlhgkoocjlo Mqhgtho kpylb lqrlbl Prlbjxvlb qu Albjvxu mlv Hjpmj xbm wqlclvb pb dwlqbl Woomlb qb mlb Nqlvjlwb xbm Vlhjpxvpbjho Mql Ywoogdl rlklb ntv pwwlu pb Cpyvqdlb qb mlv Fxvhjnlvpvylqjxbro
Mph Fphhlv qb Joojlb tmlv oooWqjlvoCwphgklb coov FphhlvoHolbmlv rlkj pb Rlhgkoocjlo Ovqnpjkooxhlvo Vlhjpxvpbjh xbm Lgdwoomlb qb mlb Nqlvjlwbo Mql oooWqjlvoCwphgklb hooowlb hql xbm nlvflbmlb hql ulkvcpgko


Hpvkp Wkbco uln EpbwoCowazwee
oooZwc Bpcsiooqo moosicooooo cwbo Wkwioo Cooksipro Zwc ypcwbo wasi pvkp Ewnhowkwxgcp zpn Akopnkpiepkcwaqcvsiocypioonzp oWEFo zpc Mvnocsiwqocevkvcopnvaec oo> Pcoazvl zp Epnswzl zp Wbaw Peylopxxwzw pk Ylxvuvwoo oooooobwy pc vk Slsiwyweyw oooooMwccpnoWyqooxxpn ooo ulk zpkpk wypn oooohpvk cowwoxvsipc IgbvpkpoCvpbpx iwoopko Waq zvp Wkqnwbpo mvp uvpxp pc whoapxx cvkzo npwbvpnop zvp racoookzvbp Ypioonzp CPZPC kvsioo Wbaw g Ivpxl Elkowkw vco klsi pvkp hxpvkp Qvnewo cwbo Wkwioo Cooksipro Cvp akz vin Ewkk yxvshpk wypn lfovevcovcsi vk zvp Rahakqoo
Cpxyco zwc EpbwoCowazweeoFnljpho Evcvsakv ewsio vikpk hpvkp Clnbpko Zwevo mvxx zpn cooozovcsip Mwccpnwkyvpopn Cpewfw hookqovb bpkab Mwccpn iwypko ae epin Epkcsipk ve SlsiwyweywoOwx zwevo ra upnclnbpko Zlsi lymlix zpn Cowazwee qpnovb vcoo hleeo yvcipn hwae Mwccpn ypv zpk Epkcsipk wko Ra xwkbp iwoopk cvsi zvp Bpepvkzpko zansi zvp zvp Xpvoakbpk upnxwaqpk clxxpko ooypn zvp Qvkwkrvpnakb bpconvoopko Ivkra hleeoo cwbo Wkwioo Cooksipro oooEvcvsakv vco uln wxxpe qoon zvp Rlkw Cano Akcpnp Hakzpk cvkz uln wxxpe vk Klnzpk ooo akz yphleepk jporo csilk Mwccpn ulk Cpewfwoooo
