Was ist dran an der „personalisierten Medizin“?
Mythen rund um diagnostische Tests: Teil 3
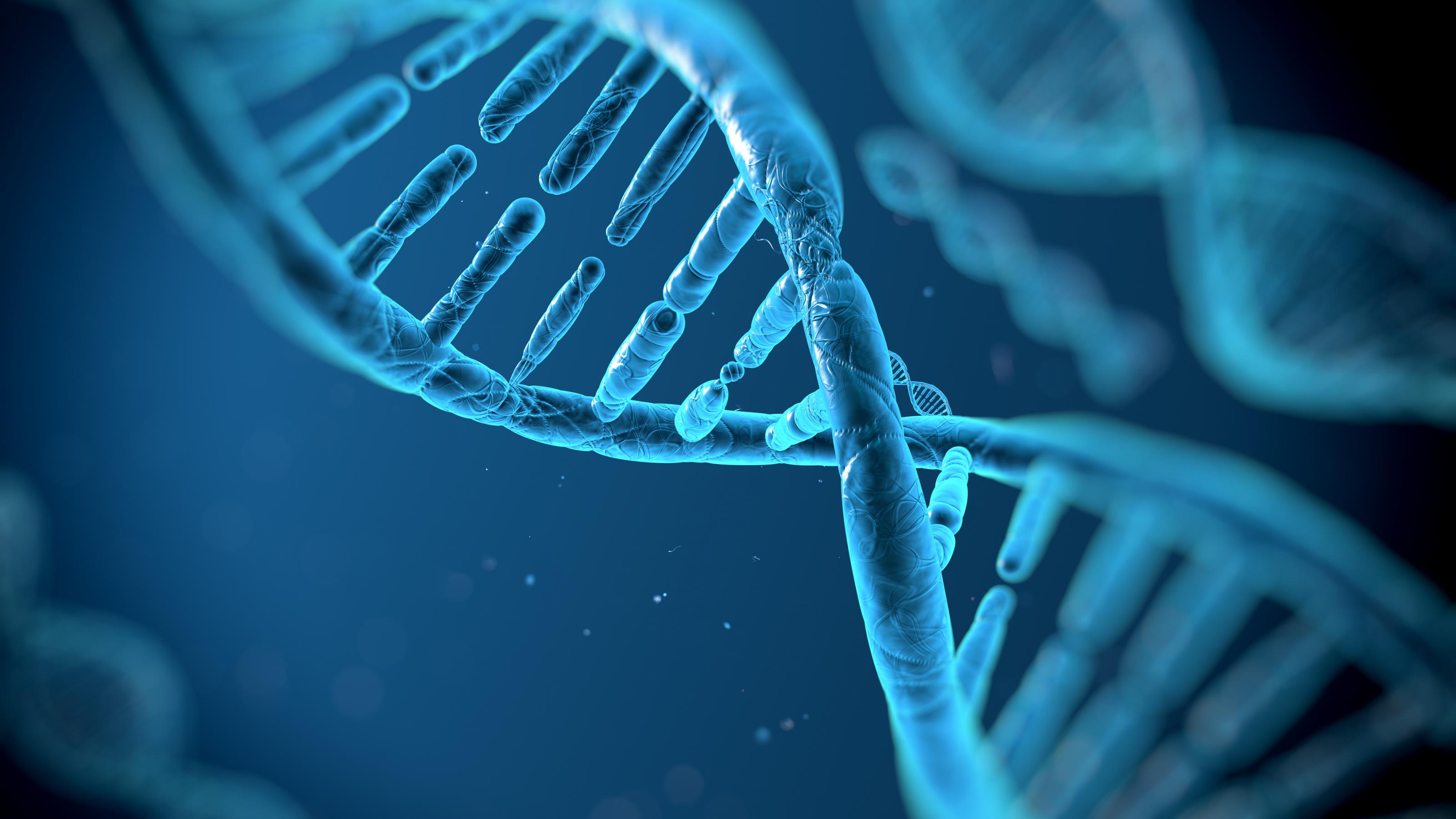
Mehr Informationen zum Projekt „Plan G: Gesundheit verstehen“ finden Sie auf der Spezialseite Besser entscheiden in Sachen Gesundheit.
Behandlungen, die ganz genau auf dich zugeschnitten sind – dieses Versprechen hört sich doch toll an, oder? Aber was steckt tatsächlich hinter der „personalisierten Medizin“ und wie gut ist der Nutzen belegt?
Deine Freundin ist an einer Depression erkrankt und erzählt dir von einer Empfehlung, die sie in der Apotheke beim Einlösen des Rezepts für ein Antidepressivum bekommen hat: Die Apothekerin hat ihr einen genetischen Test gezeigt, mit dem es möglich sein soll, das beste Antidepressivum für die betreffende Person und die ideale Dosierung herauszufinden. Allerdings kostet dieser Test knapp 400 Euro und die Krankenkasse bezahlt das nicht. Sie fragt sich, ob sich diese Investition wohl lohnt.
Solche und ähnliche Tests werden häufig unter dem Stichwort „personalisierte Medizin“ zusammengefasst. Und bei diesem Begriff werden viele Menschen hellhörig. Denn die Erfahrungen bei Ärzt*innen oder im Krankenhaus gehen in eine ganz andere Richtung: Bei der großen Anzahl an Menschen, die durch die ärztlichen Behandlungen geschleust werden, entsteht manchmal schon der Eindruck eines Fließbandes. Und oft fehlt Ärzt*innen dann die Zeit, auf den oder die Einzelne individuell einzugehen – so, wie die meisten es sich eigentlich wünschen.
Die „personalisierte Medizin“ meint allerdings nicht, dass sich deine Ärztin mehr Zeit nimmt und dafür besser bezahlt wird. Vielmehr werden mit diesem Begriff eine ganze Reihe von Ansätzen zusammengefasst, mit denen eine passende Behandlung für den konkreten Menschen gefunden werden soll.
Das ist erst einmal nichts Neues in der Medizin – schließlich wird schon seit Langem beispielsweise darauf geachtet, jemandem mit einem Magengeschwür kein Medikament zu verordnen, das die Magenschleimhaut zusätzlich angreift. Was inzwischen seit vielen Jahren aber zusätzlich genutzt wird: Genetische Informationen und andere Biomarker, die mit molekularbiologischen Methoden getestet werden. Im englischen Sprachraum ist das unter dem Begriff „precision medicine“ bekannt und wird besonders bei der Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt.
Allerdings ist weder „personalisierte Medizin“ noch „precision medicine“ präzise definiert und umfasst eine ganze Reihe von verschiedenen Verfahren, Behandlungen und Tests. In diesem Beitrag können wir uns aus Platzgründen zwar nur eine kleine Auswahl davon anschauen, spannend ist aber vor allem die Frage: Helfen die Tests tatsächlich, die richtige Therapie herauszufinden, das Ansprechen auf die Behandlung zu verbessern und die Therapie verträglicher zu machen?
Das Wichtigste in Kürze
Wenn eine Behandlung als „personalisiert“ bezeichnet wird oder ein Test Aufschluss über genetische Informationen verspricht, heißt das nicht automatisch, dass du davon profitierst. Das muss erst durch aussagekräftige Studien belegt werden. In manchen Fällen ist der Nutzen der „personalisierten Medizin“ groß, in anderen dagegen vernachlässigbar – und oft wissen wir es nach dem derzeitigen Erkenntnisstand noch nicht so genau.

Vermutlich ahnst du es schon: Die Antwort auf die Frage nach dem Nutzen der personalisierten Medizin ist ziemlich komplex.
Dass mehr Informationen nicht automatisch immer besser sind, konntest du bereits im ersten Teil unserer Mini-Serie zu medizinischen Tests nachlesen. Es braucht nämlich aussagekräftige Studien, um den Nutzen von Tests nachzuweisen. Und das gilt nicht nur für die Diagnose einer bestimmten Krankheit, sondern auch, wenn Tests auf bestimmte genetische Marker oder andere Eigenschaften zum Einsatz kommen.
Der Mythos von der vollständigen Individualität in der Medizin
Mit einem Missverständnis können wir gleich ganz am Anfang aufräumen: In der Regel werden die Behandlungsentscheidungen nicht wirklich anhand der einzigartigen Information eines einzelnen Menschen (n = 1) getroffen. Eher geht es darum, anhand der Tests die Zugehörigkeit eines Menschen zu einer bestimmten kleineren Gruppe zu identifizieren, für die bestimmte Eigenschaften bekannt sind. Von daher führt der manchmal gebrauchte Begriff der „individualisierten Medizin“ auch in die Irre. Wissenschaftlich richtiger wäre es, von „Subgruppen-Medizin“ oder „stratifizierender Medizin“ zu sprechen (Stratum = eine bestimmte kleine Menge von Menschen, die Teil einer größeren Gruppe ist). Klingt aber natürlich nicht so sexy.
Eine vollkommen „individualisierte Medizin“ hätte auch einen wesentlichen Nachteil. Das illustriert ein Zitat aus einem Vortrag von Jürgen Windeler, dem Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG):
„Es besteht natürlich keinerlei Zweifel daran, dass jeder Mensch einzigartig ist, nur ist diese Feststellung für eine Entscheidungsfindung und -unterstützung eher hinderlich als nützlich. Man möchte sich ja das erstaunte oder auch bestürzte Gesicht eines Patienten vorstellen, der nach Schilderung seiner vergleichsweise unspektakulären Symptomatik von seinem Arzt mit der Aussage konfrontiert wird:, , So einen Menschen/Patienten/Fall wie Sie habe ich noch nie gesehen […] Ich weiß daher nicht, was ich mit Ihnen machen soll.'“ [1].
Anders ausgedrückt: Es hat auch sein Gutes, dass wir in vielerlei Hinsicht anderen Menschen ähneln. Denn dann können wir zum Beispiel auch Schlussfolgerungen über den Nutzen bestimmter Behandlungen aus klinischen Studien ziehen, an denen wir nicht selbst teilgenommen haben [2].
Medizin muss mehr können als bloß Mechanismen zu finden
Was in der Diskussion um die „personalisierte Medizin“ häufig übersehen wird: Viele Erkrankungen und gerade Krebserkrankungen sind sehr komplex. Wird mithilfe eines bestimmten Tests ein definierter Marker gefunden, heißt das noch lange nicht, dass Patient*innen auch tatsächlich von einer Behandlung profitieren, die sich gegen diesen Marker richtet – auch wenn sich das vom Mechanismus her erst einmal plausibel anhört. Denn in der Regel gibt es keinen „Ein/Aus-Schalter“, sondern viele Prozesse im Körper hängen miteinander zusammen, bedingen oder regulieren sich wechselseitig. Deshalb helfen theoretische Überlegungen und Plausibilitäten nicht weiter, sondern es braucht aussagekräftige Studien, die das im komplexen Organismus Mensch testen [3,4].
Brustkrebs: Wissen und offene Fragen
Schauen wir uns das einmal anhand des Beispiels Brustkrebs an. Eigentlich verbietet sich hier der Singular, da es viele verschiedene Arten von Brustkrebserkrankungen mit unterschiedlichen Verläufen gibt. Inzwischen sind eine Reihe von Markern etabliert, die Rückschlüsse auf den Verlauf der Erkrankung, aber auch auf das Ansprechen auf bestimmte Therapien erlauben.
So wird beispielsweise im Tumorgewebe standardmäßig untersucht, ob Hormonrezeptoren vorhanden sind. Falls ja, kommt eine Behandlung infrage, die an diesen Hormonrezeptoren angreift. Allerdings wurde erst mit Hilfe von umfangreichen Studien herausgefunden, wie groß der Nutzen tatsächlich ist, in welcher Form und wie lange diese Behandlung erfolgen sollte. Und bei einigen Aspekten gibt es auch heute noch Wissenslücken [5].
Dass das Wissen um Marker alleine noch lange nicht ausreicht, zeigt auch die Diskussion um Biomarkertests bei bestimmten Brustkrebsformen: So sollen bestimmte Tests im Tumorgewebe eine Aussage darüber erlauben, wie groß das Risiko ist, dass die Krebserkrankung nach der Operation wiederkehrt. Eine praktische Konsequenz daraus kann die Entscheidung sein, sich einer Chemotherapie zu unterziehen – oder bei geringem Risiko für einen Rückfall darauf zu verzichten.
Die Krankenkassen zahlen derzeit einen von mehreren verfügbaren Tests, weil bisher nur für diesen einigermaßen belastbare Daten aus Studien vorliegen. Allerdings muss man auch wissen: Selbst mit diesen Daten bleiben noch einige Fragen offen und dieser Test hilft auch nur bei einer bestimmten Brustkrebsart in einigen wenigen Situationen bei der Behandlungsentscheidung. Bei anderen Tests fehlen bisher aussagekräftige Daten – die wären aber nötig, um den Stellenwert der Tests richtig einschätzen zu können [6].
Was nützt die Pharmakogenetik?
Das gilt auch für einen weiteren Bereich, in dem Biomarker-Tests eine Rolle spielen: die Pharmakogenetik. Dort geht es um die Frage: Wie beeinflusst die genetische Ausstattung eines Menschen, wie gut bei ihm ein Arzneimittel wirkt oder wie gut er es verträgt? Solche Tests untersuchen etwa, ob bestimmte genetische Merkmale vorhanden sind oder ob bestimmte Enzyme, die an der Verstoffwechselung von Arzneistoffen beteiligt sind, vom Körper mehr oder weniger produziert werden. Zum Teil gehören solche Tests zur Routineversorgung und werden von der Krankenkasse bezahlt, andere werden dagegen als Selbstzahlerleistung angeboten.
Dabei gibt es einige Situationen, in denen die Tests gut etabliert sind:
- So darf etwa das Krebsmittel Imatinib nur bei bestimmten Leukämie-Formen verordnet werden, wenn das sogenannte „Philadelphia-Chromosom“ nachgewiesen werden kann [7].
- Für den Wirkstoff Carbamazepin gibt es Einschränkungen bei bestimmten ethnischen Gruppen: So muss bei Patient*innen mit han-chinesischer oder thailändischer Abstammung auf bestimmte Genvarianten getestet werden, die die Immunabwehr beeinflussen (Vorhandensein des HLA-B*1502-Allels). Ansonsten drohen schwere Hautreaktionen [7].
Bei anderen Arzneistoffen ist es dagegen komplizierter und die Folgen können sehr unterschiedlich sein:
- Für den Blutgerinnungshemmer Warfarin wurde in Studien untersucht, welche Konsequenzen es hat, wenn bei der Dosierung genetische Informationen berücksichtigt werden. Im Vergleich zum herkömmlichen Vorgehen, also zum Beispiel wenn die Gerinnungswerte regelmäßig gemessen und die Dosierung angepasst wird, verbessert die Berücksichtigung der genetischen Informationen zwar die Gerinnungswerte, ändert aber nichts am Schlaganfallrisiko, das Warfarin ja senken soll. Komplex sind auch die Auswirkungen auf die unerwünschten Wirkungen: So fanden sich Hinweise, dass möglicherweise schwere Blutungen seltener werden, aber das Blutungsrisiko insgesamt verändert sich nicht [8].
- Bei bestimmter genetischer Ausstattung wird das Krebsmittel Irinotecan langsamer abgebaut. Das kann theoretisch zu einer schlechteren Verträglichkeit führen. Im richtigen Leben spielt das aber nur bei sehr hohen Dosierungen eine Rolle. Meistens wird das Mittel aber nur niedrig dosiert eingesetzt und dann macht sich das nicht bemerkbar [9].
- Bei dem Mittel Vernakalant, das gegen Herzrhythmusstörungen gegeben wird, weiß man zwar, dass an der Verstoffwechselung Enzyme beteiligt sind, und dass manche Menschen mehr und andere weniger davon haben. Es ist aber nicht notwendig, bei diesen Patient*innen die Dosis zu verändern, weil andere Stoffwechselwege diese Variation kompensieren [7].
- Für Antidepressiva gibt es bisher keine überzeugenden Belege dafür, dass pharmakogenetische Tests das Ansprechen auf die Therapie oder die Verträglichkeit verbessern [10].
Was wir an diesen und anderen Beispielen sehen können: Es gibt Arzneistoffe, bei denen in der Praxis die Pharmakogenetik eine große Rolle spielt, und solche, bei denen sich aus den genetischen Unterschieden keine nennenswerten Konsequenzen ergeben [11].
Das hindert Geschäftemacher allerdings nicht daran, auch bei unbelegtem Nutzen pharmakogenetische Tests zu bewerben. In den USA hat die Zulassungsbehörde vor einiger Zeit deshalb sogar amtliche Verwarnungen ausgesprochen und die betroffenen Hersteller mussten ihre Werbung ändern [12].
Fazit
Die Beispiele zeigen: Ob im Einzelfall die Bestimmung von Biomarkern wie genetischen Informationen tatsächlich einen Unterschied für den Nutzen und die Verträglichkeit von Behandlungen machen, lässt sich nicht theoretisch ableiten. In manchen Fällen können die Informationen über bestimmte Biomarker dabei helfen, eine wirksamere oder verträglichere Behandlung auszuwählen. In anderen Fällen liefern entsprechende Tests jedoch keinen nützlichen Mehrwert. Deshalb kannst du nicht automatisch davon ausgehen, dass „personalisiert“ immer besser ist und genetische Tests immer einen hohen Nutzen haben. Um den Stellenwert der „personalisierten Medizin“ abschätzen zu können, muss die jeweilige Therapie in Verbindung mit dem jeweiligen Test ordentlich untersucht werden [13].
Zum Weiterlesen
Alle angegebenen Websites wurden zuletzt am 17.02.2020 abgerufen.
[1] Windeler J. Individualisierte Medizin – unser (Un)Verständnis. ZEFQ 2012,106:5–10 (€)
[2] In diesem Artikel begründen die Autoren die erst einmal wenig intuitiv klingende Aussage, dass ordentlich gemachte Studien mit größeren Gruppen für einzelne Menschen wesentlich aussagekräftigere Daten liefern als die derzeit häufig durchgeführten (meist methodisch schlechten) Untersuchungen mit immer kleineren Patientengruppen. Djulbegovic B, Ioannidis J. Precision medicine for individual patients should use population group averages and larger, not smaller, groups. Eur J Clin Invest 2018; 49: e13031 (frei)
[3] Dieser Artikel beleuchet, wo sich die Verheißungen der „precision medicine“ im Bereich der Krebsmedizin erfüllt haben und wo handfeste Belege immer noch fehlen. Prasad V et al. Precision oncology: origins, optimism, and potential. Lancet Oncol 2016; 17: e81–86 (frei)
[4] Bei der Interpretation von Studien für kleine Teilgruppen gibt es einige statistische Fallstricke, die die Interpretation schwierig machen können (frei).
[5] Genauere Infos zu den Tests, die bei Brustkrebs standardmäßig durchgeführt werden, gibt es in der Patientenleitlinie des Leitlinien-Programms Onkologie.
[6] Gut verständliche, knapp gefasste Informationen zu Gentests bei Brustkrebs gibt es im Patientenportal des IQWiG. Ausführlicher beschreibt den aktuellen Wissensstand zum Test Oncotype DX der vollständige Projektbericht. Die Aktualisierung einer Bewertung von anderen Biomarker-Tests bei Brustkrebs läuft derzeit noch.
[7] Die Angaben stammen aus den offiziellen Fachinformationen von Arzneimitteln, die den jeweiligen Wirkstoff enthalten.
[8] In dieser systematischen Übersichtsarbeit werden 14 randomisierte kontrollierte Studien zusammengefasst, die die Dosierung anhand der genetischen Informationen mit dem konventionellen Vorgehen vergleichen. Yang T et al. Genotype-guided dosing versus conventional dosing of warfarin: A meta-analysis of 15 randomized controlled trials. J Clin Pharm Ther 2019; 44:197–208
[9] Der Artikel beleuchtet auch weitere Beispiele aus dem Bereich der Krebsmedizin. Darin wird auch beschrieben, wie aussagekräftige Studien zu Biomarkern aussehen müssen. Ludwig WD. Möglichkeiten und Grenzen der stratifizierenden Medizin am Beispiel von prädiktiven Biomarkern und „zielgerichteten“ medikamentösen Therapien in der Onkologie. ZEFQ 2012,106: 11–22 (€)
[10] Bei den pharmakogenetischen Tests für Antidepressiva werden verschiedene Genvarianten getestet. Die Studienlage für die einzelnen Tests beleuchtet der Artikel separat. Bschor T et al. Genetische Tests zur Steuerung der Behandlung mit Antidepressiva. Nervenarzt 2017,88,495–499 (frei)
[11] Der Artikel enthält noch einige weitere Beispiele für die (fehlende) Bedeutung von genetischen Varianten für die Behandlung mit bestimmten Arzneimitteln. Cascorbi I. Pharmakogenetik. Aktueller Stand – Fakten und Fiktionen. medgen 2017; 29:389–396 (frei).
[12] Die Details der Warnung lassen sich auf der Website der FDA nachlesen. Für eine bessere Übersicht zum Stand des Wissens hat die FDA ihre Auflistung pharmakogenetischer Tests überarbeitet und präsentiert jetzt eine Einteilung, die sich an der Relevanz für die Gesundheitsversorgung orientiert. Die Einteilung kann sich zukünftig noch verändern, weil die FDA die Studienlage noch weiter auswertet. Gleichzeitig weist die Behörde darauf hin, dass die Auflistung nicht in jedem Fall bedeutet, dass ein pharmakogenetischer Test vor der Anwendung eines bestimmten Medikaments notwendig und/oder empfohlen ist.
[13] Der Artikel beleuchtet neuere Studiendesigns mit ihren Vor- und Nachteilen, wie sie seit einiger Zeit in der Krebsmedizin eingesetzt werden. Janiaud P et al. New clinical trial designs in the era of precision medicine: An overview of definitions, strengths, weaknesses, and current use in oncology. Cancer Treat Rev. 2019; 73:20–30