Preiswürdige Biotechnologie: Der Nobelpreis und die Molekularbiologie
Nobel bepreist hat Stockholm Entdeckungen und Erfindungen zur Biotechnologie in den letzten 120 Jahren. Und das, obwohl es überhaupt keinen Nobelpreis für Biotechnologie gibt.

Die Biotechnologie hat bereits eine Geschichte von mehr als einem Jahrhundert hinter sich. Tatsächlich kombiniert der Mensch aber schon seit Jahrtausenden Biologie und Technik – denken wir an die Vergärung zuckerhaltiger Flüssigkeiten zu alkoholischen Getränken durch Hefen. Inzwischen ist Biotechnologie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken – selbst wenn uns das bei diversen Nahrungsmitteln oder Medikamenten gar nicht bewusst ist.
Auch Nobelpreise werden seit mehr als einem Jahrhundert vergeben, zum ersten Mal war es 1901 so weit. Einen Nobelpreis für „Biotechnologie“ gibt es nicht. Stattdessen hatte Alfred Nobel in seinem Testament „Medizin oder Physiologie“ als eine Kategorie festgelegt. Das deckte Biologie und medizinische Forschung mit ab – also alles, was man heute unter „Lebenswissenschaften“ oder Life Sciences zusammenfasst. Vielleicht würde der Preisstifter mittlerweile differenzieren zwischen Genetik, Biochemie und sogar Biotechnologie.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wusste die Welt noch nichts von Nukleinsäuren im Zellkern als Speicher der Erbinformation. Doch die Naturwissenschaften waren im Umbruch: Forscher verstanden den Aufbau der Materie aus Atomen und Molekülen ebenso wie die chemischen Grundlagen des Lebens immer besser. Sie begannen, Prozesse gezielt zu modifizieren, zum Beispiel, um Diabetiker mit Insulin zu behandeln.
Insulin gegen Diabetes
Wenn wir Kohlenhydrate essen, zerlegt unser Körper sie in handliche Zuckerhäppchen. Diese versorgen die Zellen mit lebenswichtiger Energie. Das Hormon Insulin öffnet dem Zucker sozusagen die Tür vom Blut in die Körperzellen. Bei einer Diabetes-Erkrankung fehlt Insulin. Die Folge: Der Blutzuckerspiegel ist zu hoch und trotzdem „hungern“ die Zellen.
Für die Entdeckung des Insulins ging 1923 ein Nobelpreis an die kanadischen Ärzte Frederick Banting und John Macleod. Die beiden Forscher hatten die Substanz aus der Bauchspeicheldrüse isoliert. Injizierten sie das Hormon Diabetikern, nahmen deren Zellen wieder Zucker auf und der Blutzuckerspiegel sank. Das war eine Revolution: Eine zuvor tödliche Erkrankung wurde behandelbar.
Ab dem Jahr 1923 stellte die Firma Hoechst Insulin-Präparate für die Diabetes-Therapie her, zunächst aus Bauchspeicheldrüsen von Schweinen oder Rindern. Doch das tierische Insulin ist nicht identisch mit dem des Menschen. Insulin besteht aus einer Kette von 51 Aminosäuren, also Proteinbausteinen. Die genaue Abfolge unterscheidet sich zwischen verschiedenen Tierarten. Wenig überraschend: Für den Menschen am besten verträglich ist menschliches Insulin.
„Humaninsulin“ produzierte Hoechst ab 1983. Zunächst bearbeiteten die Frankfurter dafür Schweine-Insulin mit speziellen Enzymen, um es verträglicher zu machen. Heute geht das einfacher: Die Aminosäure-Abfolge des Insulins ist nämlich genetisch festgelegt. Nehmen Biotechnologen also ein Insulin-Gen mit der menschlichen Sequenz und setzen es in spezielle Helfer-Bakterien ein, so produzieren diese humanes Insulin. Die Hoechst-Nachfolgefirma Sanofi nutzt seit Beginn des Jahrtausends das Bakterium Escherichia coli, um Insulin herzustellen. Übrigens: Je nachdem, wofür die Gentechnik und Biotechnologie zum Einsatz kommt, hat sich eine Art Farbcode durchgesetzt: Rote Biotechnologie widmet sich medizinischen Anwendungen, die grüne Variante der Pflanzenzucht, und die weiße Biotechnik steht für industrielle Herstellungsverfahren. Inzwischen gibt es eine breite Farbpalette der Biotechnologie.
Gentechnik brachte die Biotechnologie einen großen Schritt nach vorn. Doch springen wir zurück in die 1920er-Jahre: Denn bis Forscher die Sache mit den Genen wirklich verstanden hatten, sollten noch einige Jahrzehnte vergehen.
Als das Erbmolekül entdeckt wurde
Die Antwort fanden sie im Zellkern. Dort liegen die Chromosomen, dicht gepackte Strukturen aus Eiweißen und Nukleinsäuren. Letztere sind bekannt als Desoxyribonukleinsäure – kurz „DNS“ oder international „DNA“ (weil „Säure“ im Englischen „Acid“ heißt). Die chemische Zusammensetzung der DNA war bereits bekannt. Niemand konnte sich aber vorstellen, wie diese Moleküle Information speichern. Das änderte sich 1953, als die Molekularbiologen Francis Crick und James Watson wohl eher aus einer glücklichen Intuition und einem gewissen Erfindergeist heraus die molekulare Struktur beschrieben, zunächst hypothetisch.
DNA sieht aus wie eine verdrehte Strickleiter, mit zwei langen Strängen außen und zahlreichen Sprossen. Jeder Strang besteht aus nur vier unterschiedlichen DNA-Basen, die sich scheinbar wahllos millionenfach aneinander reihen. Damit die Stränge zur stabilen Leiter werden, greifen immer zwei benachbarte Basen ineinander und bilden die Sprossen. Dabei haben sie Lieblingspartner: Die Base Cytosin mag nur Guanin, während Adenin und Thymin untrennbar sind.
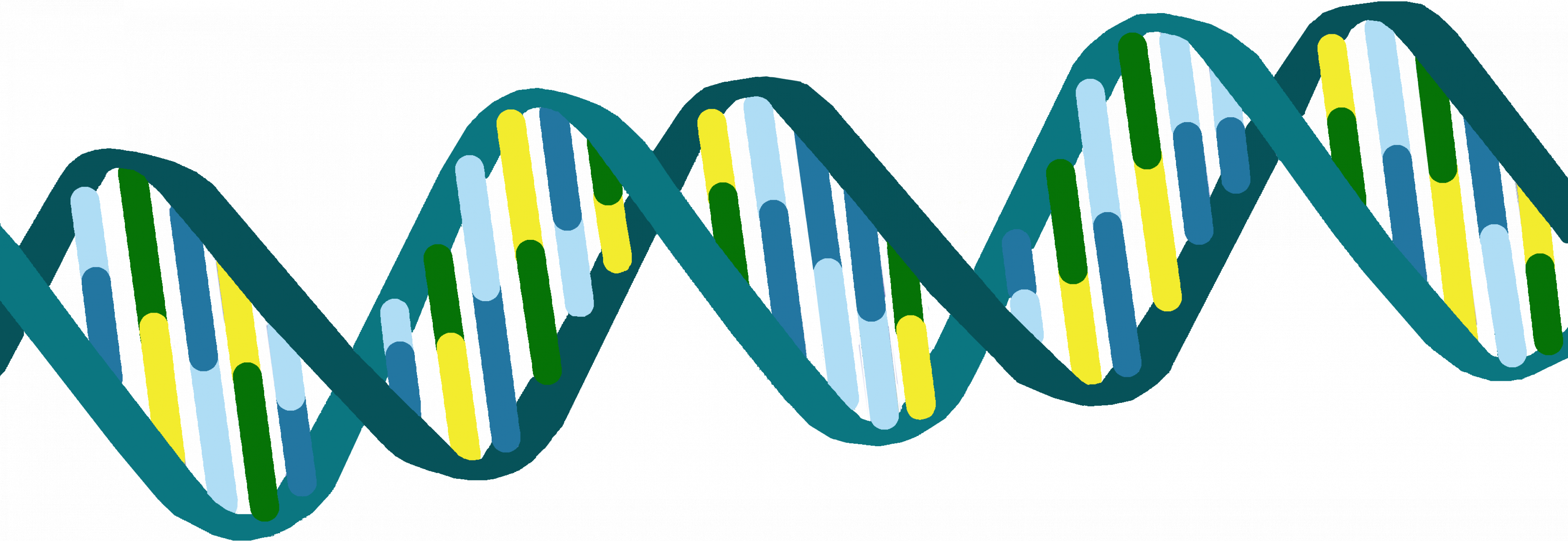
Wissenschaftler nennen dieses Konstrukt eine Doppelhelix. Welche Informationen sich in einem DNA-Stück verbergen, ergibt sich aus der Reihenfolge, in der die Basen auf den Strängen liegen. Das ist der genetische Code, unsere Erbinformation.
Und noch etwas fanden Watson und Crick heraus: Um Gene zu vervielfältigen, teilen sich die beiden Stränge und werden – jeder für sich – Stück für Stück mit neuen Bausteinen wieder zu einem Doppelstrang ergänzt. Damit konnten die beiden Forscher erklären, wie Zellen ihre DNA-Moleküle kopieren und so Informationen nicht nur speichern, sondern auch vererben. 1962 gab es dafür den Nobelpreis, den sich die beiden Molekularbiologen mit dem Physiker Maurice Wilkins teilten. Wilkins‘ Untersuchungen zur Röntgenstreuung durch DNA lieferten den Beweis, dass unser Erbgut tatsächlich als Doppelhelix vorliegt. Genauer gesagt waren es Messungen der Chemikerin Rosalind Franklin, die mit Wilkins gemeinsam in einem Labor arbeitete. Als ihre drei Mitstreiter den Nobelpreis erhielten, war Franklin aber bereits verstorben.
Was nun folgte, war eine regelrechte Explosion von Erkenntnissen, wie genau Zellen genetische Informationen auf der DNA auslesen, um daraus Proteine herzustellen. Die wiederum steuern und regulieren als Enzyme verschiedene Prozesse, bilden Stützgerüste in der Zelle, formen Membrankanäle und fördern wie kleine Maschinen gezielt Material herein oder hinaus. Die DNA bestimmt über die Abfolge der Basen, aus welchen Aminosäuren ein Protein aufgebaut wird. Dazu erstellen Enzyme kleine handliche DNA-Kopien, Boten- oder messenger-RNAs, kurz: mRNA. RNA steht dabei für Ribonukleinsäure. Der Begriff der mRNA erlangte zuletzt Berühmtheit, weil diese Moleküle Teil der neuen Corona-Impfstoffe sind.
DNA im Labor kopieren
DNA, RNA und Proteine – dieser Dreiklang ist der Werkzeugkasten moderner Biotechnologie und erlaubt es, Organismen so zu verändern, dass sie biotechnologisch nutzbar sind. Ein weiterer Meilenstein in diese Richtung war deshalb die Möglichkeit, ausgewählte DNA-Stücke auch im Labor in großer Zahl kopieren und vermehren zu können. Dafür nutzen Forscher ein Enzym, die DNA-Polymerase. Sie vervollständigt halbe „Strickleitern“ wieder zu einer Doppelhelix. Voraussetzung: Ein kurzer Platzhalter bindet am DNA-Strang, damit die Polymerase andocken und verlängern kann.
Das klingt simpel, machen Wissenschaftler im Labor doch scheinbar nur das nach, was in Zellen ohnehin stattfindet. Tatsächlich aber müssen sie mit Temperaturen jonglieren – immer wieder und über viele Zyklen hinweg. Bei hohen Temperaturen lösen sich die DNA-Stränge voneinander und die Polymerase bindet am Einzelstrang. Sinkt die Temperatur, setzt das Enzym Baustein für Baustein an den „alten“ Strang und schafft dadurch wieder einen Doppelstrang. Jeder Doppelstrang wird so innerhalb eines Zyklus’ verdoppelt, im nächsten erneut und so weiter. Damit war die Polymerase-Kettenreaktion erfunden – kurz: PCR. Auch wenn es Ansätze zur DNA-Vervielfältigung schon in den 1970ern gab, so war es der US-amerikanische Biotechemiker Kary Mullis, der 1985 mit der PCR die Technik alltagstauglich machte. Im Jahr 1993 wurde Mullis hierfür mit einem Nobelpreis geehrt.
Mit der PCR war es nun möglich, DNA-Fragmente gezielt zu vermehren. Das nutzen Biotechnologen und andere Forscher, um sie dann zum Beispiel in Bakterien oder Pflanzen einzusetzen und diese genetisch zu verändern. Ebenso lassen sich mittels PCR aber auch kleinste Spuren von DNA nachweisen, indem man die DNA so oft verdoppelt, bis sie mit anderen Methoden sichtbar wird. Seit März 2020 kennen wir alle ja die PCR als SARS-CoV-2-Nachweismethode.
Gene umschreiben
Mullis bekam den Nobelpreis übrigens nicht für „Medizin oder Physiologie“ sondern in der Kategorie „Chemie“. Ebenso wie die Biochemikerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna im Jahr 2020. Ja, wir machen einen gewaltigen Sprung in Richtung Gegenwart. Und viele Nobelpreisträger haben wir unerwähnt gelassen, obwohl sie die Biotechnologie von heute überhaupt erst möglich gemacht haben.
Charpentier und Doudna gehören zu den wenigen Frauen in der Geschichte des Nobelpreises, die durch das Komitee Beachtung fanden. Ausgezeichnet wurden sie für die Entwicklung der Gen-Schere CRISPR/Cas9, einem molekularbiologischen Werkzeug zum Editieren von DNA. Was genau ist dieses „Gene Editing“?
Gentechnisch veränderte Organismen herzustellen ist schon lange kein Hexenwerk mehr – denken wir an die Bakterien, die menschliches Insulin produzieren. Forscher können die im Labor üblichen Escherichia coli-Bakterien relativ leicht dazu bringen, fremde DNA aufzunehmen. Komplizierter ist es, genomische DNA zu verändern, also das Erbgut eines Organismus’. Das machen Wissenschaftler, um die Eigenschaften zum Beispiel von Pflanzen oder Tieren zu verändern. Bislang waren solche Mutationen mehr oder weniger Glücksache, zufällig ausgelöst durch Bestrahlung, chemische Substanzen oder DNA-schneidende Enzyme. Das Problem: Bei diesen Methoden entstehen verschiedene Mutationen an vielen Orten im Genom, und der Forscher muss aus der Masse den Organismus herausfischen, der die gewünschte Veränderung zeigt. Das kostet Zeit und Geld.
Ein bestimmtes Gen gezielt zu verändern, ist mit der CRISPR-Cas9-Schere einfacher. Das Prinzip haben sich Doudna und Charpentier aus Bakterien abgeschaut, denn die nutzen die Genschere zur Viren-Abwehr. Die beiden Biochemikerinnen haben dieses Werkzeug für den Laboreinsatz angepasst und so dem Baukasten der Biotechnologie hinzugefügt.
Auch das Gene Editing verläuft nicht immer reibungslos. Ebenso hat die gesamte Biotechnologie sicher noch lange nicht ihr Potential ausgeschöpft. Es wird also auch künftig Nobelpreise für Ideen und Entdeckungen rund um die Biotechnologie geben.