#music4climate – Musik in der Klimakrise
Brauchen die Aktivist:innen eine Hymne? Oder gibt es schon eine Playlist?

Musik hat oft eine entscheidende Rolle dabei gespielt, gesellschaftliche Strömungen und soziale Bewegung zusammenzuschweißen und mitzureißen. Daher liegt die Frage nahe, ob es geeignete Songs gibt, die Menschen in der Klimakrise mobilisieren. Auch wenn die Mechanismen der Musik-Industrie ein Hindernis bilden – das Potenzial ist offenbar da, und viele Künstler:innen haben schon Stücke vorgelegt. Wir könnten sie unter dem Hashtag #music4climate bündeln.
„We shall overcome“ sangen sie, als sie in Selma/Alabama die Brücke überquerten. Drüben warteten am Bloody Sunday im März 1965 der Sheriff sowie die uniformierten Schläger des rassistischen Gouverneurs George Wallace. Doch die Demonstranten um Martin Luther King und John Lewis ließen sich – das Lied auf den Lippen und in den Ohren – nicht abschrecken. Der Marsch über die damals wie heute nach einem Ku-Klux-Klan-Führer benannte Brücke hatte das Ziel, das Wahlrecht der schwarzen Einwohner Selmas durchzusetzen. Er wurde zu einer der entscheidenden Szenen der US-Bürgerrechtsbewegung.
Der Song „We shall overcome“, den Pete Seeger und vor allem die damals 22-Jährige Joan Baez gesungen haben, wurde weltberühmt und gehört noch heute zum Standard-Repertoire bei Protestmärschen aller Art. Die Menschen machen sich damit Mut, fassen sich an den Händen, versichern sich gegenseitig, dass Gemeinschaft Schutz bietet und ihre gerechte Sache siegen wird. Das Lied entstammt der Musik der schwarzen Sklaven und der US-Arbeiterbewegung. Das Musik-Magazin Rolling Stone hat es zur „Erkennungsmelodie der Bürgerrechtsbewegung“ erklärt.
Deren Ziele haben sich auch durch viele andere Songs, die zum Teil weit oben in den Hitparaden standen und im Radio rauf und runter liefen, in die Gehirne der damals jungen Menschen gebrannt. Sam Cookes „A change is gonna come“ oder Nina Simones „Mississippi Goddam“ sind wichtige Beispiele. Und weil das Thema in der politischen Diskussion präsent blieb, kam auch immer neue Musik hinzu: Bob Dylans „Hurricane“ zum Beispiel, „Killing in the name“ von Rage Against The Machine oder „Black Rage“ von Lauryn Hill. Die Metapher der Klaviertasten, die eben nur gemeinsam Harmonie und Vielfalt ermöglichen, nahmen dabei im Abstand einiger Jahrzehnte Paul McCartney und Stevie Wonder („Ebony & Ivory“) sowie Katie Melua („Spiders Web“) auf. So wurde das Thema immer wieder für neue Generationen fortgeschrieben.
Ähnliche Geschichten könnte man vermutlich in Deutschland für die Anti-Atom-Bewegung, die Rechte Homosexueller und den Widerstand gegen Neonazis erzählen. Doch wo ist diese Musik für den Kampf gegen die Klimakrise? Hat die Protestbewegung Fridays for Future (FFF) eigentlich ihre eigenen Hymnen? Wo sind die Stücke, die alle Klima-Bewegten zusammen singen oder mindestens zusammen anhören können; wo die Hits bekannter Künstler:innen, die im Bus zur Demo lauter gedreht werden? Wo ist die Musik, die eine neue Identität als Klimaschützer:in emotional in der Seele verankert? Gehen wir auf die Spurensuche.
Die Sinnfrage: Was kann Musik bewirken?
Bei der Recherche dieser Fragen trifft man auf viele interessierte, aber meist eher ratlose Fachleute. Eine fertige Antwort hat niemand, etliche erkennen aber das mobilisierende Potenzial von Popsongs. Manche bezweifeln hingegen, ob Musik eine kommunikative und letztlich politische Wirkung entfalten kann; andere, ob Texte überhaupt wahrgenommen oder verstanden werden. Unklar bleibt ebenso, ob sich das spröde Thema Klima für gute Songs eignet. Und ob die aktuellen Mechanismen der Musik-Industrie es überhaupt noch erlauben, öffentliche Sorgen statt privater Träume zum Thema zu machen. Und dann geht es auch um die Frage, ob sich ein Effekt erkennen und gar messen ließe, falls sich über die Genres hinweg viele Musiker:innen mit der Klimakrise auseinandersetzten.
Am Anfang steht dabei so etwas wie die Sinnfrage: Was kann Pop mit seinem Elementen Melodie, Rhythmus, Text, Video bewirken? Die Debatte reicht zurück zu Theodor Adorno. Er hat in den frühen 1960er-Jahren die Grundzüge einer Soziologie der Musik entworfen und dabei bestritten, dass man sich von populären Stücken eine gesellschaftliche Wirkung versprechen könne. Es sei „unmöglich, einen Zustand, der in den realen ökonomischen Bedingungen gründet, durch ästhetischen Gemeinschaftswillen zu beseitigen“, schrieb er. Und in diesem Fall geht es sogar in doppelter Hinsicht um ökonomische Bedingungen: einerseits die Zwänge der Musikindustrie, andererseits die globalisierte Wirtschaft, die von fossilen Energierohstoffen abhängt.
Aber Musik als Kommunikationsmittel zu prüfen, kann sich durchaus lohnen, wenn man historische Vergleiche heranzieht, stellt Thorsten Philipp von der Technischen Universität Berlin fest. „Wie die Protestsongs der Anti-AKW-Bewegung eindrucksvoll zeigen, ist das Lied auf subtile Weise Teil eines (…) Lern- und Reifegeschehens“, schreibt in einem Aufsatz von 2018. Damit könnten „Menschen das Dickicht ihrer Abhängigkeiten, Bevormundungen und Fremdsteuerungsmechanismen verlassen und eine Position der Stärke finden“.
In einem Buchkapitel aus dem Jahr 2019 ergänzt der Politologe, der zurzeit über Nachhaltigkeit in Popsongs habilitiert: Durch Text, Musik und Vorführung spreche der Popsong eine „Vielfalt an Sinndimensionen“ an und könne in seiner „Verstärkerfunktion die sonst gängigen Mittel der politischen Kommunikation weit übertreffen“. Der Inhalt sei zwar oft weniger Politik und mehr „Politainment“, aber in dieser Form trage Musik die Wahrnehmung ökologischer Probleme „in gesellschaftliche Schichten (…), die für konventionelle Wege der Nachhaltigkeitskommunikation kaum zugänglich sind“.
Das Potenzial ist also da, aber kann man es auch nutzen? Und es bleibt die Frage: Gilt das nur die Protestsongs aus der Singer-Songwriter-Szene, oder auch für die Stücke von Musiker:innen, die eher auf Erfolg, Ruhm und Charthits aus sind?
Songs gibt es genug
Mit Musik zu kommunizieren, wird in der aktuellen Situation vermutlich nicht an der Quantität scheitern. Wer nach Songs sucht, die speziell das Klima aufgreifen, findet schnell einige Dutzend. Fasst man das Thema weiter als Nachhaltigkeit oder Umweltschutz, sind es sogar einige Hundert.
Wikipedia zum Beispiel kennt Musikstücke über die Umwelt von ungefähr 350 englischsprachigen Sänger:innen und Bands. Vieles davon beklagt die Achtlosigkeit der Mitmenschen oder beschwört die kommende Katastrophe herauf wie zum Beispiel „In the year 2525“ von Zaker and Evans aus dem Jahr 1969 oder das 50 Jahre jüngere „All good girls go to hell“ von Billy Eilish. Eine Weile lang war das Motiv der vergifteten Flüsse ein großes Thema, das zum Beispiel die Beach Boys und der County-Sänger Johnny Cash aufgriffen (in beiden Fällen hießen die Songs „Don’t go near the water“). Auch Bäume spielen in vielen Stücken die zentrale Rolle zum Beispiel bei Joni Mitchell („Big Yellow Taxi“) – und natürlich gibt es dazu auch vieles auf Deutsch, angefangen bei Alexandra („Mein Freund, der Baum“).
Außerdem hat die Jugendbewegung FFF durchaus Dynamik ins Thema gebracht: Etliche Künstler haben ihr Stücke oder sogar Alben gewidmet. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich MusicForFuture nennt. Die Beteiligten haben zum Beispiel den Song „Green Utopia“ produziert, dessen Video zum großen Teil auf Demonstrationen gefilmt wurde. Ein weiteres Stück, „Fight every crisis“, entstand mit Hilfe von Klang-Samples einiger Dutzend prominenter Unterstützer:innen. Zum globalen Klimastreik 2019 hatten Aktivist:innen auch etliche Playlisten mit teilweise mehr als 100 Songs zusammengestellt, von denen freilich nur eine kleine Zahl wirklich von der Klimakrise handelte. Eine Spotify-Playliste mit 35 Einträgen zum Beispiel enthielt neben einigen einschlägigen Songs Stücke zum Mutmachen, die auf jedem Protestmarsch gut ankommen, wie „Get up, stand up“ von Bob Marley & The Wailers.
Die Suche nach einer Hymne
Auch Vorschläge einer FFF-Hymne gibt es mittlerweile etliche. In einem lassen die Komponisten Sprechchöre von den Demonstrationen allmählich in treibende Tanzmusik übergehen, dann gibt es einen Song zur Akustikgitarre, und beim Stück „Long forgotten road“ sieht man im Video Kinder und Jugendliche, die zum Gesang der Schweizer Musikerin Scilla Hess die Lippen bewegen.
Allerdings ist das so eine Sache mit Hymnen – sie müssen nicht unbedingt Eins zu Eins vom Thema der Gruppe handeln, die sie sich aussucht. So wurde der Disco-Klassiker „I will survive“ von Gloria Gaynor zum Erkennungs- und Motivationssong der LGBTQI+-Szene, obwohl es im Text erkennbar um eine gescheiterte Hetero-Beziehung ging. Die Überhöhung ihres Songs und die Vielzahl ihrer Regenbogen-Fans waren der streng-gläubigen Christin Gaynor auch nicht wirklich geheuer.
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär’ nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt (Die Ärzte)
Schon eher passte der Text eines Fleetwood Mac-Songs zur Aussage der Kampagne, mit der sich Bill Clinton 1992 um die US-Präsidentschaft bewarb. Nach acht Jahren unter Ronald Reagan in die Zukunft zu blicken, dazu konnte man gut auch „Don’t stop thinking about tomorrow“ singen. Die Band war einverstanden – sie fand sich sogar für einen Abend wieder zusammen und spielte das Stück 1993 bei einem der Bälle zu Clintons Amtseinführung. Donald Trumps Wahlkampf traf hingegen auf den Widerstand vieler Musiker:innen, deren Songs in den Hallen liefen; ein Wikipedia-Artikel listet zwei Dutzend Beispiele. Mindestens im Fall von Bruce Springsteens „Born in the USA“ hatten die Republikaner und die mitgrölenden Fans die Aussage des Songs auch schlicht missverstanden. Und als der Sänger Wahlwerbung für Hillary Clinton machte, wurde er sogar ausgebuht.
Ein Song mit dem Potenzial zur FFF-Hymne findet sich auf vielen Playlists; er ist deutlich älter als die Bewegung, drückt aber deren Grundhaltung bemerkenswert klar aus – und der Refrain lässt sich gut mitsingen. „Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist“, sangen die Ärzte schon 2004. „Es wär’ nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt.“
Ohnehin ist es mit einem Protest- oder Erkennungssong der Klimabewegung vermutlich ohnehin nicht getan; kaum jemand wird ihn im Alltag unbewusst vor sich hinsummen oder beim Radiohören aufmerken. Wenn es nicht viele Bands und Sänger:innen gibt, die sich gegenseitig inspirieren und anstacheln, die Breite des Ausdrucks erweitern und immer neue Genres erschließen, um sich schließlich bei Festivals zu treffen, bleibt der eine Song für Demos reserviert.

Von Willen und Wirkung
Das bringt uns zu der Frage, wie die Aussichten auf ein solches breites Spektrum neuer Klimasongs stehen – oder auch nur auf den Anfang einer solchen Entwicklung. Popmusik ist ja meist ein knallhartes Geschäft; es geht um Geld, Ruhm, Einfluss, die sich alle vielleicht besser erreichen lassen, wenn man die Kundschaft nicht aufwühlt. Ganz im Sinne von Adorno, der ja den Einfluss von Popmusik auf die Gesellschaft grundsätzlich bestritten hatte.
Allerdings kann, wer solche Stücke schreibt, das grundsätzlich auch mit einem künstlerischen Anspruch tun, sagt der Berliner Wissenschaftler Thorsten Philipp. Das hieße, Probleme aufzugreifen, „die im Unterbewusstsein einer Gesellschaft weiterwirken“. Probleme also, die ungelöst dastehen, aber nicht hinreichend kommuniziert, nicht anerkannt und nicht diskutiert werden. Das würde zum Beispiel für die zu wenig besprochenen Folgen der Klimakrise perfekt passen und wäre dringend nötig.
Ob auf diese Weise der Wille der Musiker:innen, in ihren Stücken etwas über die Gesellschaft auszusagen, regelmäßig den Anfang eines solchen kreativen Prozesses bildet, das bezweifelt der Berliner Politik-Wissenschaftler allerdings. Vielleicht schreiben Liedermacher:innen zuerst ein Gedicht, das sie dann vertonen; bei Popsongs aber entstehe ein Text mit einer gesellschaftlichen Aussage wenn überhaupt gegen Ende der Produktion. „Es ist praktisch nicht zu klären, ob ein Künstler den Willen verspürte, dass sich etwas verändern soll“, sagt Philipp, „oder irgendjemand in seinem Team angenommen hat, ein solcher Song könne in der aktuellen Zeit erfolgreich sein.“ Im letzteren Fall werde dann oft eine Legende für die Öffentlichkeit gestrickt, um ersteres vorzutäuschen.
Das könnte einem fast egal sein, wenn sich denn die Wirkung solcher Titel belegen ließe. Allerdings ist hier die Datenlage dünn: Die Effekte von Musik mit – wissenschaftlich gesprochen – prosozialem Inhalt sind wenig untersucht. Umgekehrt gibt es schon eher Daten über gewaltverherrlichende, aggressive oder rechtsradikale Songs. Eine Studie unter Teenagern in den USA, die sich über den Zeitraum von einem Jahr erstreckte, ergab zum Beispiel: Aggressive Musik war mit mehr Aggression und weniger prosozialem Verhalten verknüpft, und viele Jugendliche, die Songs mit sexuellem Inhalt hörten, begannen früher mit ihrem Sexualleben. Das ist wenig überraschend, und das dritte Resultat zudem noch entmutigend: Thematisierten die gehörten Stücke prosoziales Verhalten, war überhaupt kein Effekt zu erkennen.
„Gute“ Musik soll einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten (Nicolas Ruth)
Andere Untersuchungen ergeben immerhin einige anspornende Daten. So ließ der Musikpsychologe Nicolas Ruth für eine Studie in einem Cafe in Würzburg im Wechsel zwei verschiedene Playlisten laufen. Darauf standen jeweils die gleichen Sängerinnen, Musiker und Bands, aber entweder mit Songs von prosozialem oder neutralem Inhalt. Oder, wie Ruth es ausdrückt, „gute“ Musik und normale. Von Michael Jackson ertönte entweder „Earth Song“ oder „Thriller“, und P!nks „Dear Mr. President“ wechselte sich ab mit „Raise your glass“.
Was das Experiment für seine Doktorarbeit bewirkte, erfasste der Psychologe vom Goldsmiths College in London über den Absatz von Fair-Trade-Kaffee. Das Personal ließ den Gästen stets zwei Songs lang Zeit, ein wenig zuzuhören. Es fragte dann beim Aufnehmen der Bestellung direkt, ob die Kund:innen bereit seien, 30 Cent Aufschlag für ihr Heißgetränk zu bezahlen. Dafür würde es dann aus Bohnen mit einem Siegel hergestellt, das den Erzeugern höhere Erlöse verspricht. Lief die prosoziale Playliste, dann bestellten 38 statt 18 Prozent der Gäste das teurere, prosoziale Produkt. Der Psychologe selbst warnt aber davor, vom einmaligen Hören des „Earth Song“ eine Art Umkehr zu erwarten. „Davon allein wird doch niemand zur Umweltschützer:in.“
Die Musik der eigenen Jugend
Gleichzeitig kennt die Psychologie das Phänomen des „reminiscence bump“. Menschen erinnern sich besonders gut an die Erlebnisse, die sie im Alter von ungefähr 10 bis 30 Jahren geprägt haben – danach verändert sich der Musikgeschmack oft kaum noch. Aber die vielfach gehörten Songs der Jugend, die bleiben präsent. „Man könnte schon annehmen, dass Musik mit einer expliziten politischen Botschaft, die man zum Beispiel zum Thema Klimakrise in dieser Lebensphase immer wieder hört, das Denken und Handeln langfristig beeinflusst“, sagt die Musikwissenschaftlerin Ann-Kristin Herget von der Universität Würzburg. Ergebnisse bisheriger Studien deuteten in diese Richtung, aber explizit wurde gerade dieser Sachverhalt noch nicht untersucht..
Dazu muss sich allerdings einiges ändern, denn die Funktion der meisten Songs der aktuellen Popmusik ist ja eher, die Menschen von ihren Sorgen abzulenken, wie schon der große Anteil der Liebe-Herz-Schmerz-Freunde-Reisen-Party-Songs belegt. Bis auf wenige Nischen und vielleicht mit Ausnahme großer Stars widersprechen sich kommerzieller Erfolg auf der einen Seite und künstlerisch-kritischer Anspruch sowie Eintreten für gesellschaftlichen Wandel in den Liedern auf der anderen Seite. Das muss aber nicht so bleiben: „Wir haben zurzeit ein immer weiter erstarkendes Umweltbewusstsein, womöglich wird das Thema daher in Zukunft stärker aufgegriffen“, spekuliert Herget. „Wenn wir Glück haben, ergibt sich ein sich selbst verstärkendes Moment.“
Das Niveau, von dem aus der erhoffte Anstieg starten könnte, ist aber recht niedrig. Als Nicolas Ruth die deutschen Jahreshitparaden auswertete, in Fünf-Jahres-Schritten von 1954 bis 2014, da handelten 57 Prozent der Titel von Liebe und knapp 4 Prozent von prosozialem Verhalten. Immerhin hatten es diese wenigen Ausnahmen aber nicht nur so eben auf die Liste geschafft, sondern ordentliche Platzierungen erreicht; womöglich gerade deswegen, weil sie Ausnahmeerscheinungen waren. Zu den Beispielen gehören „In The Ghetto“ von Elvis Presley (1969), „YMCA“ von den Village People (1979) oder „Irgendwas bleibt“ von Silbermond (2009). Im Jahr 1994 belegten die Songs mit prosozialem Inhalt die Plätze 2,9 und 12 der Jahres-Hitparade mit „I swear“ von All-4-One, „All for you“ von Bryan Adams, Rod Stewart und Sting sowie „United“ von Prince Ital Joe und Marky Mark.
Dabei bleibt natürlich immer die Frage, wie viel vom Text Zuhörer:innen tatsächlich verstehen. Da ist zum einen die Sprachbarriere, wenn internationale Musik in Deutschland gespielt wird, und zum anderen die Frage, wie viel davon an den Ohren vorbei dudelt oder aufmerksam wahrgenommen wird. Aber bei Hits, die immer wieder laufen und dann im Radio oder Freundeskreis diskutiert werden, bekommen die Meisten vermutlich zumindest in Grundzügen mit, wovon das Stück handelt.
Meist sind Musiker:innen mit den Worten weiter als mit den Texten
Viele Songs der Popgeschichte beschäftigen sich kritisch mit der Gesellschaft oder der Umwelt, aber meist sind solche Stücke Inseln im Œuvre der Künstler:innen. Deren gesellschaftliches Engagement eilt den Inhalten ihrer Musik oft weit voraus. Selbst bei einer Aktion wie den Live-Earth-Konzerten war das so, die auf Initiative des Klimaaktivisten und ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore am 7. Juli 2007 auf allen Kontinenten stattfanden. Hier handelte nur ein Bruchteil der Stücke der aufgebotenen Superstars überhaupt von Umweltproblemen, soweit sich das anhand der veröffentlichten CD und DVDs sowie von Youtube-Clips beurteilen lässt.
Eine der wenigen Ausnahmen war „I need to wake up“ von Melissa Etheridge, das aus dem Soundtrack zu Gores Film „Eine unbequeme Wahrheit“ stammt. Der Titel „Hey You“, den Madonna exklusiv für das Festival schrieb, ist hingegen vom Text her eher ein allgemeiner Aufruf, für gemeinsame Ziele auch gemeinsam zu streiten – erst das Video machte das Thema etwas spezifischer.
Musik ist die universelle Sprache und der Klimawandel die globale Sorge. Da gibt es eine natürliche und wichtige Synergie. (Jessica Smith und Rebecca Foon)
Es gab zwar im Umfeld der Konzerte viele wichtige Informationen über Klimaschutz, und was bekannte Musiker:innen sagen, ist natürlich auch nicht unwichtig. Aber gesungene Worte haben eine emotionale Wirkung, die gesprochenen oder geschriebenen Appellen fehlt. Zudem vermisste mindestens der Kritiker der Zeit die nötige systemverändernde Botschaft des ganzen Unternehmens. Es bekräftige eher die Mechanismen des Kapitalismus und gebe Anlass zu weiterer „Geschäftemacherei im Namen des Guten“.
Um viele Größenordnungen kleiner sind die Veranstaltungen der Organisation Pathway to Paris, deren Name sich auf das Pariser Abkommen von 2015 bezieht. Sie wurde von Jessica Smith, der Tochter von Patti Smith („Because the Night“), und ihrer Partnerin Rebecca Foon gegründet, die wiederum auch Songs über das Thema schreibt. Es soll Musik sein, heißt es auf der Webseite, die „Bewusstsein ausdrückt und zur Aktivität anregt, damit die dringend nötigen Transformationen den Planeten heilen und retten“. Die Organisation lädt zu Konzerten ein, die zugleich Lesung, Happening und Kunstperformances sind (hier ist der Link zu einer Aufzeichnung aus San Francisco aus dem September 2018 auf Facebook; das eigentliche Programm beginnt in der Minute 25).
Der Fußabdruck der Musikindustrie
Die Logistik solcher Veranstaltungen, besonders wenn es große Festivals sind, macht den ganzen Musik-Betrieb zu einer Treibhausgas-Schleuder; das gilt genauso für Konzert-Tourneen. Da werden Sattelschlepper voll Material durch die Welt geschickt, die Bands schweben per Flugzeug ein, große Hallen werden geheizt, gekühlt, beleuchtet und beschallt. Von einer Wiese bleiben nach einem Open-Air-Festival nur Matsch und Müll.
„Die Industrie lebt von Mobilität, Materialität und Ressourcenverbrauch“, sagt der Musikwissenschaftler Wolf-Georg Zaddach, der das Thema an der Hochschule für Musik in Weimar sowie der Leuphana-Universität Lüneburg untersucht. Weil Künstler:innen seit einiger Zeit kaum mehr etwas am Verkauf von CDs verdienen und Streaming auch sehr wenig einbringt, müssten viele sogar um so mehr touren, um ihr Einkommen zu erzielen, beklagt er. Ob die zahlreichen Umwelt-Initiativen in der Musikszene gegen diesen Trend ankommen, sei darum eher fraglich.
Auf einem toten Planeten gibt es keine Musik (Music declares emergency)
Gegen die mit Konzerten verbundene Umweltbelastung wendet sich zum Beispiel das Green Touring-Netzwerk, das an der Popakademie in Mannheim entstanden ist. Ein vielseitiger Leitfaden gibt dort Tipps zur Routenplanung, Beleuchtung, der Anreise der Fans oder dem Merchandising. „Wenn die Musikindustrie es schafft, mit gutem Beispiel voranzugehen (…), kann das im Endeffekt Auswirkungen auf die Politik und tatsächliche Änderungen im gesamtgesellschaftlichen Kontext bedeuten“, sagt die Gründerin Fine Stammnitz in einem Interview. „Die Kommunikation des Themas Nachhaltigkeit sollte ein weiterer Bestandteil der künstlerischen Identität sein.“
Aushängeschild der Initiative ist zurzeit die Band Coldplay, die schon vor der Corona-Pandemie bekanntgab, keine Konzerte mehr zu geben, bis ein Konzept für umweltfreundliche Tourneen vorliegt. Aber das muss man sich auch leisten können; wären nicht die Hallen und Clubs wegen Corona dicht, hätten sich auch viele klimabewegte Musiker:innen auf Konzertreise begeben.
Ähnliche Ziele verfolgen Reverb.org und Music declares emergency. Der zweiten dieser Initiativen haben sich bisher mehr als 2000 Musiker:innen von Annie Lennox über die Bands Massive Attack und Radiohead bis Zoë Keating angeschlossen; hinzu kommen gut 1000 Organisationen, Plattenfirmen und Veranstalter. Hier geht es auch um die Umweltfolgen von Konzerten: Zum Beispiel sollen dort keine Einweg-Plastikbecher verkauft und CDs in Papier- statt in Kunststoffhüllen vertrieben werden.
Der Hauptaugenmerk von Music declares emergency liegt aber auf der politischen Botschaft, für die die Unterzeichner:innen eintreten wollen: zum Beispiel die Emissionen von Treibhausgasen bis 2030 praktisch einzustellen und Netto-Null zu erreichen (das bedeutet, dass die Natur genauso viel CO₂ zusätzlich aufnimmt, wie aus unvermeidlichen Quellen noch freigesetzt wird). „Auf einem toten Planeten gibt es keine Musik“, steht in großen Lettern auf der Webseite der Initiative.
Als eine Stimme der Kunst versteht sich auch die Organisation Artists 4 Future. Darin haben sich in Deutschland fast 3000 Musiker:innen und andere Kulturschaffende versammelt und hinter die demonstrierenden Jugendlichen von FridaysForFuture gestellt. Der erste Aufruf vom April 2019 enthält allein drei Seiten voller Namen, darunter sind Dota Kehr, Max Mutzke und Konstantin Wecker.
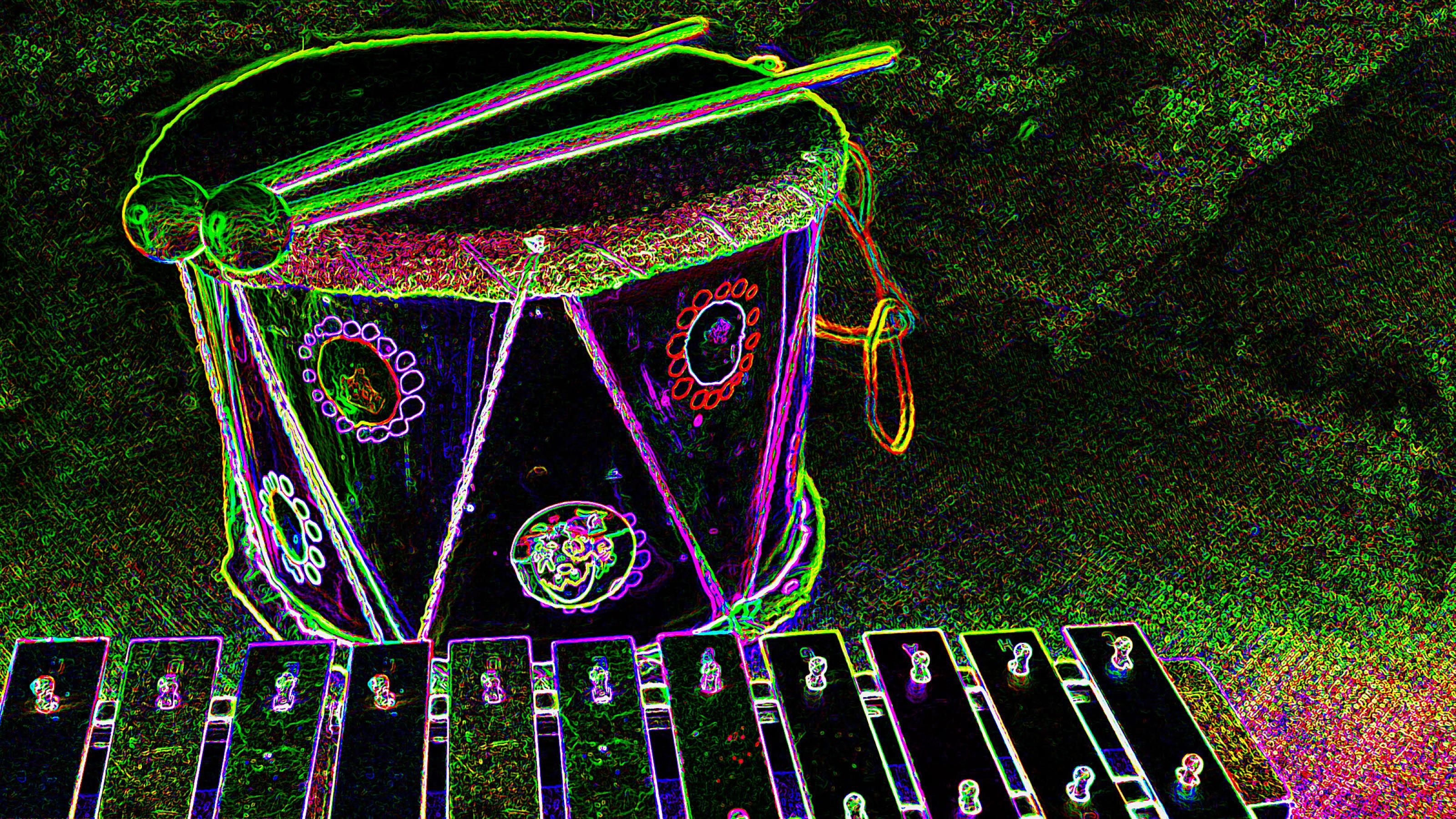
Das Klima in Songs behandeln
Warum aber spielt trotz solcher Initiativen das Klima bisher noch in wenigen neuen Songs eine Rolle? Einigen Musikredakteur:innen, die ich zu dem Thema befragt habe, fielen zunächst kaum Beispiele ein (vielen Dank trotzdem an Anja Caspary von Radio Eins, Lars Weisbrod von der Zeit und Jakob Biazza von der Süddeutschen Zeitung).
Es könnte zum Beispiel sein, dass die gesellschaftliche Ungerechtigkeit der Klimakrise den Künstler:innen noch nicht im gleichen Maß bewusst ist oder gar von ihnen erlebt wird wie etwa bei Rassismus oder Sexismus. Oder dass sie sich schlechter an Personen aufhängen lässt, mit denen das Publikum tatsächlich etwas anfangen kann, sowohl in der Rolle von Opfern wie von Schurken. Sollte das stimmen, dann wirkt hier die psychologische Distanz weiter, die viele Kommunikations-Fachleute als Grundproblem auf dem Weg vom Wissen zum Handeln ausgemacht haben.
Damit verknüpft ist die mögliche Sorge der Musiker:innen, das „Diktat zur Coolness“ zu verletzten, wie Jakob Biazza vermutet. Die Ursachen und Folgen der Klimakrise sind ja kompliziert, die gängige Meinung ist oft noch, dass es um unverständliche Naturwissenschaft oder sehr technische Lösungen geht. Um persönlich Verantwortliche zu finden, an denen man sich im Text reiben kann, muss man in die Reihen der Konzernbosse oder Politiker:innen blicken. Biazza fürchtet, dass einem dann im Wesentlichen „nur noch Phrasen einfallen“.
Mindestens dabei könnte ein Seitenblick ins Genre der Klima-Literatur („CliFi“) helfen. Die Autor:innen der Romane interessieren sich auch dort im Wesentlichen für das Verhalten ihrer Figuren unter den radikal veränderten Bedingungen der Klimakrise. Diese ist also, auch wenn sie dystopische Folgen hat, eher Ausgangspunkt als Gegenstand der Handlung (hier der Link zu einer Reihe von Rezensionen in einem KlimaSocial-Artikel). Genauso wenig müssen Popsongs zur Klimakrise von Überschwemmungen oder Dürren sprechen und sich auf das Jammern über das Verlorene beschränken – der Blick auf die viele Umweltsongs zeigt auch eine breite Vielfalt von Textideen, Stimmungen und Formen. Ironie und Sarkasmus sind dabei auffällig oft vertreten.
Jeder Song muss eine Single sein
Gewichtiger als die Sorgen um die Qualität eines Texts sind vielleicht die Mechanismen der Musikindustrie. Sie hat sich mit dem Übergang vom Verkaufen der Tonträger zum Vermieten der Inhalte zum Pauschalpreis (etwas anderes ist Streaming ja nicht) grundlegend verändert – und dabei ihren CO₂-Fußabdruck noch erhöht. „Heute versucht jeder Song, eine Hit-Single sein“, sagt Lukas Pizon vom Musikverlag Peermusic in Hamburg. „Sie werden im Abstand weniger Wochen veröffentlicht, und das wichtigste Ziel ist es, in die entsprechenden Playlisten der Streaming-Dienste zu kommen.“ Das funktioniert wie früher beim Radio zum Teil mit persönlichen Kontakten und Tauschgeschäften. Aber etwa die Hälfte der Listen befüllen laut Pizon Algorithmen, die Musikqualität „beurteilen“ und womöglich auch Texte „lesen“. Was da gesellschaftlich aneckt, wird womöglich aussortiert – das beeinflusst natürlich die Kreativität und den künstlerischen Anspruch.
Die Generation FFF braucht Musik nicht mehr als Kondensationskeim – die haben sich ja schon gefunden (Lukas Pizon)
Diese Verhältnisse lassen kaum noch die Möglichkeit, dass Songs mit Aussage mitsegeln, weil sie auf einem Album veröffentlicht werden, das die Fans wegen einiger darauf enthaltener Hits kaufen. Musik entsteht zudem weitgehend am Fließband mit immer wieder neu zusammengesetzten Teams. Sie zielt auf den Geschmack von immer enger definierten Zielgruppen. Und bei vielen Künstler:innen wird der persönliche Ausdruck von digitalen Produktionsmethoden ausgebügelt: Software korrigiert die Tonhöhe beim Gesang oder legt die Akkorde der Gitarren auf vorgegebene Taktzeiten.
„Die Durchschlagkraft, die ein politischer Song vor langer Zeit vielleicht haben konnte, die ist heute kaum mehr möglich“, sagt Pizon. Das weckt zunächst wenig Hoffnung darauf, dass eine breite Vielfalt von Musik zur Klimakrise die ethischen Normen ihrer Zuhörer:innen beeinflusst. Immerhin brauche jedenfalls die Generation der FFF-Mitglieder die Musik nicht mehr als Kondensationskeim – „die haben sich ja schon gefunden“, erklärt Pizon.
Für die Zukunft sieht er im Wesentlichen zwei Gruppen, die wichtig sein können. Zum einen vermögen sich Superstars den Zwängen zu entziehen (ein Kommentar zum Thema auf klimafakten.de fordert darum Klima-Songs zum Beispiel von Nena und Herbert Grönemeyer). Und zum anderen schaffen es manche Künstler:innen, sich ihre eigene Nische und Fan-Basis zu erspielen, die dann Songs mit Aussage erwartet. Ein Beispiel ist die Berliner Liedermacherin Dota Kehr.
Mit einem Song ihrer Band Dota fängt auch eine Playliste deutscher Songs zur Klimakrise an, die ein Teilergebnis dieser Recherche ist (Links dazu folgen unten). Viele davon wurden von Twitterfollowern von Lars Weisbrod eingesandt – vielen Dank für die Hilfe. Sie widerlegen einmal mehr die Befürchtung, dass ernste Themen stets langweilige Texte ergeben. Es geht nicht immer direkt um das Klima, oft auch um Umweltschäden, ein grundsätzliches Unbehagen am Umgang der Menschheit mit ihrem Planeten oder die eingeschränkten Chancen der Jugend auf ein gutes Leben. In einigen Fällen ist es auch erst das Gesamtpaket von Gesang und Videoschnitt, das die Aussage eindeutig macht.
Es lohnt sich, hier zu stöbern. Viel Spaß und gute Inspiration! ◀
Die Recherche zu diesem Thema ist im Rahmen der Arbeit am Handbuch Klimakommunikation entstanden. Dort wird ist ein Kapitel erschienen, das Formen von Kunst und Kultur sowie Humor und Spiele auf ihre Eignung in der Klimakommunikation untersucht.
Links zu den #music4climate-Playlisten
Deutsche Playliste mit Links zu Youtube-Videos
Deutsche Playliste bei Spotify
Internationale Playliste mit Links zu Youtube-Videos
Internationale Playliste bei Spotify