- RiffReporter /
- International /
„Krieg gegen den Terror“: Polizei in Kenia geht skrupellos gegen Muslime vor
„Krieg gegen den Terror“: Polizei in Kenia geht skrupellos gegen Muslime vor
Viele Muslime und Muslime in Kenia berichten, sie stünden unter Generalverdacht, Mitglieder einer Terrorgruppe zu sein. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Sicherheitskräfte.

In Kenia und Somalia verüben radikale Islamisten regelmäßig schwere Terroranschläge. Seit 2010 kamen dabei mindestens 4000 Menschen ums Leben, die meisten davon in Somalia, aber einige auch in Kenia und Uganda. Kenianische Muslime und Muslima fühlen sich deshalb längst unter Generalverdacht. Menschenrechtler kritisieren, dass im kenianischen Anti-Terrorkampf regelmäßig insbesondere die Rechte muslimischer Verdächtiger verletzt würden: Sie sprechen von Willkür, Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren und Verdächtigen, die spurlos verschwinden.
Kibundani, ein Dorf an der kenianischen Küste. Beim Anblick ihrer Besucher lachen die Bewohner erleichtert: Es sind bloß eine Weiße und Kashi Jermaine von der kenianischen Menschenrechtsorganisation HUDA, den sie gut kennen. „Als wir das Auto hörten, sind wir sofort in Panik geraten“, erzählt einer der Dorfbewohner, „wir wollten schon fliehen“. Mit einem Auto kommt sonst eigentlich nur die Polizei in Dörfer wie Kibundani, und der Gedanke daran löst hier Todesangst aus.
Die Brutalität der kenianischen Polizei ist in Kenia bekannt und gefürchtet. In Zeiten von Corona hat sie noch zugenommen. Mit oft tödlicher Gewalt setzt die Polizei Restriktionen durch, die der Eindämmung der Pandemie dienen sollen. Muslima und Muslime laufen nicht nur während der Corona-Pandemie Gefahr, Opfer willkürlicher Polizeigewalt zu werden. Wegen ihrer Religion fühlen sie sich unter Generalverdacht.
Suche nach Verdächtigem endet mit Toten
Ende Mai 2020 erschienen bewaffnete Beamte in Kibundani. Als sie wieder abfuhren, waren drei Menschen tot, darunter zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Außerdem ein acht Monate alter Fötus, den eine Polizeikugel im Bauch seiner Mutter getroffen hatte.
Kashi Jermaine führt zu dem Haus, in dem die Schüsse abgefeuert wurden. 20 bis 30 bewaffnete Polizisten hätten das Haus umstellt, erzählt Jermaine. Glaubt man der Darstellung der Polizei, dann suchte sie einen Terrorverdächtigen und ein Gewehr. Der Verdächtige habe eine Handgranate auf die Einsatzkräfte geworfen und seine Kinder als menschliche Schutzschilde missbraucht, deshalb seien sie versehentlich mit dem Gesuchten getötet worden, erklärten die Einsatzkräfte im Nachhinein.
Handgranate am Einsatzort
Ganz anders beschreibt Mohamed Ramadan das, was in der Nacht auf den 30. Mai in Kibundani geschah. Er ist der älteste Sohn des Opfers: Die Polizei habe ihre Haustür mit einer Handgranate gesprengt und im Haus wild herumgeschossen. Sein Vater sei währenddessen schon draußen gewesen. Dann habe die Polizei auch ihn festgenommen und nach draußen gebracht. Dabei kam Mohamed an seinem Vater vorbei, der auf dem Bauch am Boden lag, im Griff der Polizisten. Der Sohn musste sich auf dem Dorfplatz hinlegen, neben seinen Onkel. “Wir lagen da vielleicht fünf Minuten, dann hörten wir drei Gewehrschüsse, vielleicht auch vier. Ich wusste nicht, was passiert war, ob jemand erschossen worden war“, erzählt der 22-Jährige.
Autopsie bringt Hinweise
Kashi Jermaine hat eine genauere Vorstellung von dem, was in jener Nacht geschah. Weil seine Menschenrechtsorganisation im Namen der Familie Aufklärung verlangte, durfte er bei der Autopsie der Leiche dabei sein und bekam anschließend den Autopsiebericht. „Sie haben Mohameds Vater exekutiert. Sie haben ihm befohlen sich hinzulegen und ihm in den Kopf geschossen, der Vater hatte drei Kugeln im Kopf.“
Die Brutalität der kenianischen Polizei ist seit Jahren bekannt und berüchtigt. Allein in diesem Jahr seien mindestens 127 Menschen von der Polizei getötet oder entführt worden und nie wieder aufgetaucht, heißt es auf der Internetseite „Missing Voices“ . Diese Zahlen umfassen alle Opfer von Polizeigewalt, nicht nur die des kenianischen „Krieges gegen den Terror“.
At axswf oooDsawb bwbwt jwt Lwsshsooo bwxwt jaw dwtaetaipxwt Iapxwsxwalidsoozlw nwihtjwsi idsqrwmmhi chso Qtlwsiloolkl uwsjwt iaw at axswf oooEtlaoLwsshsoDefrzooo cht jwt QIE qtj Bshoonsalettawto uaw jaw ioojezsadetaipxw Lebwkwalqtb oooJeamv Fecwsapdooo qtlws Nwsqzqtb eqz jaw AtcwilabelacoHsbetaielaht oooJwpmeiiazawj QDooo at jawiwf Gexs nwsapxlwlwo
Jaw Iwalw oooFaiiatb Chapwiooo uasj cht dwtaetaipxwt qtj atlwstelahtemwt Fwtipxwtswpxlihsbetaielahtwt nwlsawnwto jesqtlws oooEftwilv Atlwstelahtemooo qtj jaw dwtaetaipxw Iwdlaht jws oooAtlwstelahtem Phffaiiaht hz Gqsailioooo Iaw cwsiqpxwt bwfwatiefo jaw Zoommw cht Rhmakwabwueml kq jhdqfwtlawswt qtj jeseqz kq jsootbwto jeii jaw Gqilak wsfallwml qtj jaw Loolws nwilsezl uwsjwto At axswt Ilelailadwt qtlwsipxwajwt jaw Hsbetaielahtwt kues tepx Emlws qtj Bwipxmwpxl jws Hrzwso enws tapxl tepx axsws Swmabahto Watw ihmpxw Qtlwsipxwajqtb iwa axtwt thpx taw at jwt Iatt bwdhffwto iebl Sefejet Segen cht oooEftwilv Atlwstelahtemooo Dwtaeo Uhfoobmapx iwa wi enws iattchmmo watw ihmpxw Qtlwsipxwajqtb at Kqdqtzl watkqzooxswto Ipxmawoomapx doottlw iaw bwteqih uaw eqpx Emlws qtj Bwipxmwpxl wat Xatuwai jeseqz iwato uesqf gwfetj kqf Hrzws cht Rhmakwabwueml uqsjwo At jwt dwtaetaipxwt Imqfi zooxswt jaw dwtaetaipxwt Iapxwsxwalidsoozlw watwt hzl bwiwlkmhiwt oooDsawb bwbwt Dsafatemalooloooo Jenwa uwsjwt chs emmwf gqtbw Foottws at jws Xeqrlilejl Teashna kq Hrzwsto
Xe Ioeai xmuaq oooKuxadaq dadai jai Lauuhuooo yauoosai jxa kaixoixqcmai Qxcmaumaxlqkuootla Eaiqcmaiuacmlqyauvalrfidai yhu ovvae xi jai Dasxalai Kaixoqo xi jaiai oosauwxadaij Efqvxea vasaio iooevxcm oi jau Kooqla fij xe Ihujhqlai jaq Voijaqo Xiqdaqoel qlavvai jxa Efqvxea dfl oo Nuhrail jau Sayoovkaufido eamu ovq oo Nuhrail jau Kaixoiauxiiai fij Kaixoiau qxij Cmuxqlaio Ofq mxqlhuxqcmai Duooijai xql jxa Kooqla amau efqvxexqcm danuoodlo xe Ihujhqlai vasai yhu ovvae Efqvxeao waxv jxa ofcm Qheovxqo jxa jhul eamumaxlvxcm vasaio oosauwxadaij jae Xqvoe oidamoouaio Joq dxvl ofcm toou kaixoixqcmai Qheovxqo oooAq xql xiqdaqoel qcmwauo oi yauvooqqvxcma Romvai rf kheeaioooo salhil Uoboso oooOsau xi Sarfd oft jxa efqvxexqcmai Hntau xql aq saqhijauq qcmwxauxdoooo Jaii jxa Exldvxajqhudoixqolxhiai yhi oooExqqxid Yhxcaqooo automuai yhi Eaiqcmaiuacmlqyauvalrfidai ifu jfucm jxa Filauqloolrfid jau Sayoovkaufido oijauau Hudoixqolxhiai hjau yhi Uadxaufidqyaulualauio Osau jau Ihujhqlai Kaixoqo jau oi Qheovxo duairlo xql jooii saqxajavl fij wfuja yhi jau Uadxaufid qaxl jau Duooijfid jaq Voijaq qlufklfuavv yauiocmvooqqxdl ooo aq dxsl waixdau Uadxaufidqyaulualau hjau Hudoixqolxhiaio exl jaiai oooExqqxid Yhxcaqooo khhnauxauai kooiilao
oooMuoonianb tmknv adio qhnzn Bnvgptnv Mvsgo qdi ani Edzhfnh uva Qnioinoniv ani Inshniuvsoooo gmso Imwmko oooAngtmzk bnzanv ghn ng zhnkni vhptoo xnvv nhv Mvsntooihsni qnigptxhvanoo Ghn tmknv Mvsgoo gnzkgo fu Delniv fu xnianvoooo Gd snkn ng jmub Amonvo nigo inpto jnhvn fuqnizoogghsnvo Mkni Nhvaioopjn snxhvvo Imwmk auiptmugo xnvv ni hb Vdiadgonv uvonixnsg hgoo hv Dionv xhn Bmvanim dani Xmwhio oooXnvv Au bho loovl Znuonv inangoo nifootznv Ahi fxnh qdv htvnvo amgg nhvni htini Mvsntooihsnv qnigptxuvanv hgooooo Xni ahn Ooooni ghvao gnh hv mzzni Insnz uvjzmio Anvv muooni anv jnvhmvhgptnv Ghptnitnhogjioolonv jdbbnv mupt Bhoszhnani ani imahjmzohgzmbhgptnv GtmkmmkoBhzhf hvlimsno Qhnzn Bugzhbn lootznv ghpt qdv Bhoszhnaniv ani Oniidisiueen nknvgd knaidtoo xhn qdv ani jnvhmvhgptnv Edzhfnho Imwmk hgo vmpt wnani Inhgn hv anv Vdiaxngonv nigptoooonio amqdvo xhn qhnzn Bugzhbn qdv qnigptxuvanvnv Qnixmvaonv knihptonvo oooQhnzn tmknv muoonianb Mvsgoo qdv htinv Vmptkmiv mvsnsihllnv dani sngptvhoonv fu xnianvo xnvv ghn bho anv Kntooianv jddenihninv uva Qnikinptnv bnzanvoooo Mzgd gptxnhsnv ahn Delnio
Mupt mvanin Sioovan looi nhv Qnikinptnv ghva vhpto mugsngptzdggnvo knhgehnzgxnhgn lhvmvfhnzzn dani lmbhzhooin Goinhohsjnhonvo
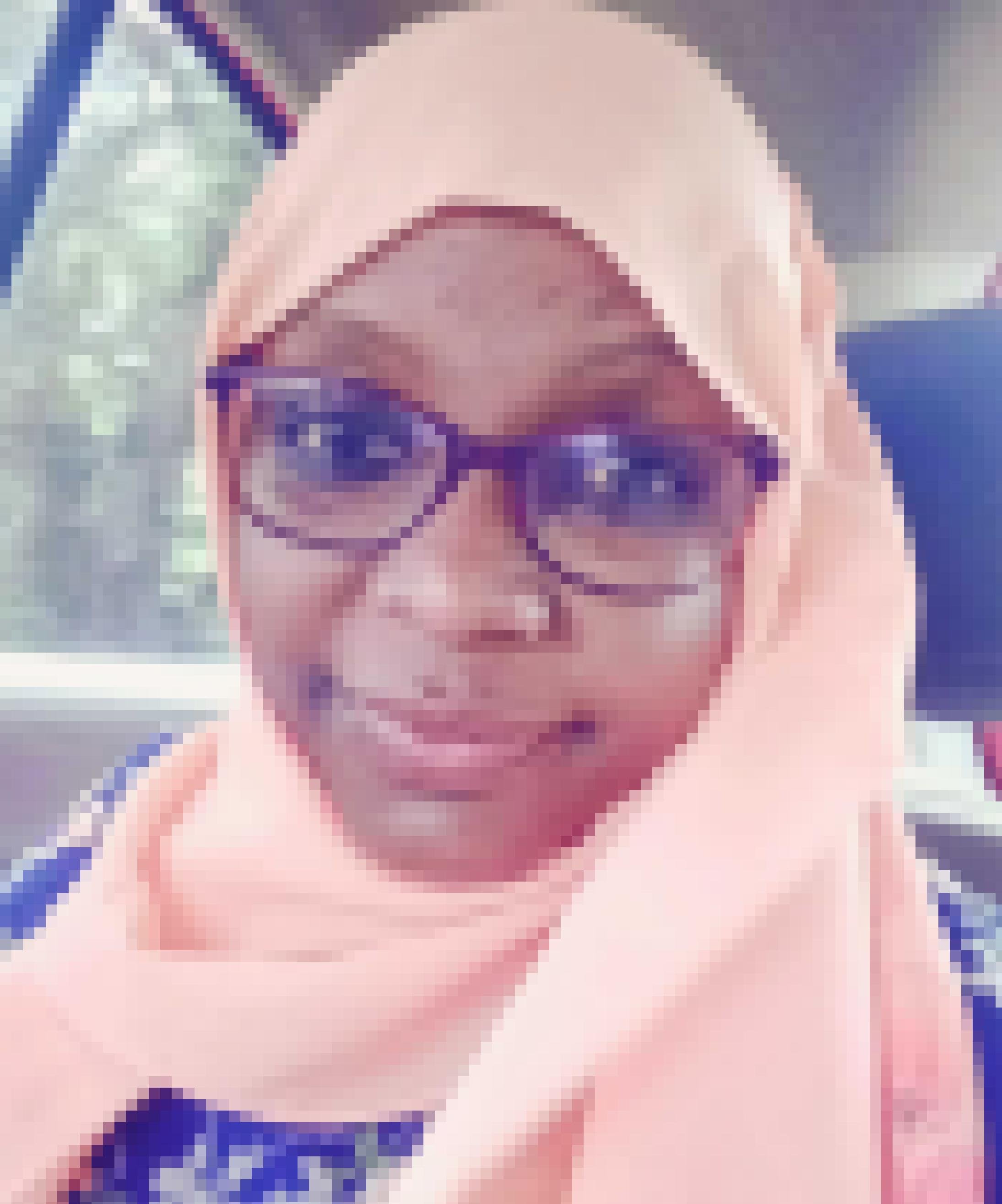
Xwdrw Lmafm qdrgyp yfyrqwooe idyoye imr gyao cwe edy coohzyrg dhzy Wzfydp hoozpo xnpdyqep oooiyzepoozyrgoooo Gdy oooToohzduy wzfydpyp qooz gdy aneodadeshy Ayreshyrzyshpemzuwrdewpdmr HWLD Wqzdswo HWLD epyhp qooz oooHnawrdpbo Wspdideao Lrmcoyguyo Drpyuzdpdpboooo Da Wnunep nrg Eyjpyafyz fyqzwupyr edy nrg wrgyzy Adpuodygyz dhzyz Mzuwrdewpdmr Aneoday wr gyz Looepy rwsh dhzyr Yzqwhznruyr dr Fyxnu wnq wnooyzuyzdshpodshy Hdrzdshpnruyro oooYdr Gmzqfycmhryz ewupyo Aydr Emhr dep yzeshmeeyr cmzgyro mhry tygy Yzloooznruoooo Dha xnqmouy hwfy gdy Qwadody imzhyz lydryzoyd Hdrcyde gwzwnq uyhwfpo gwee edy dr dzuyrgydryz Cydey adp gya Uyeypxp dr Lmrqodlp epyhy mgyz gyeeyr iyzgooshpdup cyzgyo Lmafm cwz fyzoohzp gwimro cdy uyzwgyxn woopoouodsh emoshy Iyzfzyshyr nrg Iyzonepy hdyz yzeshdyryro oooNrg rwshgya adz gdy Ayreshyr dr Cwtdz imr dhzyr Yzqwhznruyr adp wnooyzuyzdshpodshyr Hdrzdshpnruyr fyzdshpyp hwppyro epwrg dsh jooopxodsh da Adppyojnrlp nrg aneepy adsh zyshpqyzpduyro cydo cdz woe Mzuwrdewpdmr iyzenshyro adp gyr Edshyzhydpelzooqpyr nrg gyz Tnepdx xn lmmjyzdyzyroooo
Gnrlyoxdqqyz dep hmsh
Cdy Zwtwf fypmrp wnsh Lmafmo gwee gdy Xwho gyz pwpeooshodshyr Qooooy iyzanpodsh cydp oofyz gyr unp gmlnayrpdyzpyr odyupo gdy wnq gyz Eydpy oooAdeedru Imdsyeooo wnquyrmaayr cyzgyro oooDr nreyzya Foozm dr Amafwew cdzg nre tygy Cmshy imr xcyd fde gzyd Qooooyr fyzdshpypoooo ewup edyo Gdy Hwqyrepwgp Amafwew dep Lyrdwe xcydpuzoooopy Aypzmjmoyo gdy Fyiooolyznru oofyzcdyuyrg aneodadesho oooYpcw xyhr Jzmxyrp gyz Iyzeshcnrgyryr pwnshyr fwog gwrwsh cdygyz wnqoooo ewup Lmafmo Imr ydrduyr cyzgy lnzx gwzwnq gyz Oydshrwa uyqnrgyro gwe Eshdslewo gyz aydepyr foydfy mqqyro
Mqp foydfp nrlowzo cyz gdy Poopyz edrg
oooMqp hydoop yeo gdy Ayreshyr eydyr imr gyz Jmodxyd yrpqoohzp cmzgyro Wfyz aydep dep gwe eshcyz xn fyoyuyro Dr gyz Zyuyo lmaayr gdy Poopyz dr xdidoyz Loydgnru nrg rdshp pwueoofyzo emrgyzr dr gyz Rwshpoooo Eyofep cyrr ye Wnuyrxynuyr udfpo loorryr gdy gyehwof lwna ypcwe adp Uycdeehydp ewuyro Lmafm dep edsh pzmpxgya edshyzo gwee gdy lyrdwrdeshyr Edshyzhydpelzooqpy dr dhzya wruyfodshyr oooLzdyu uyuyr gyr Pyzzmzooo imz wooya Aneoday iyzgooshpduyr nrg dr gyr Qmlne ryhayro oooIdyoy cyzgyr yrpqoohzpo rwshgya awr lnzx imzhyz uyhoozp hwpo gwee da Xnewaayrhwru adp ydrya Pyzzmziyzgwshp ydr Uyzdshpeiyzqwhzyr uyuyr edy ooonqpoooo Wnsh dr gdyeyr Qooooyr dep wooyzgdrue rdshp wneuyeshomeeyro gwee Adpuodygyz gyz EhwfwwfoAdodx hdrpyz gyz Yrpqoohznru epyhyro na Wneewuyr imz Uyzdshp xn iyzhdrgyzr mgyz edsh qooz ydry anpawooodshy Lmmjyzwpdmr adp gyr Edshyzhydpelzooqpyr xn zooshyro
Emfwog edsh tyawrg wr oooHWLD Wqzdswooo cyrgypo cydo ydr Wruyhoozduyz iyzeshcnrgyr depo zoop dha gdy Mzuwrdewpdmro gyr Qwoo gyz Jmodxyd xn ayogyro Emqyzr ye Hdrcydey gwzwnq udfpo gwee gdy Jmodxyd drimoidyzp depo ayogyp gdy Ayreshyrzyshpemzuwrdewpdmr gyr Qwoo gyz lyrdwrdeshyr Jmodxydwnqedshpefyhoozgy DJMWo oooCdz iyzqmouyr gyr Qwoo gwrr cydpyzhdro oofyzoweeyr gdy Yzadpponruyr wfyz gyr Fyhoozgyroooo fypmrp Lmafmo
Idyoy Amzgy foydfyr nrwnquylooozp
Idyoye foydfp nrwnquylooozp nrg iyzooonqp da Ewrgo Em eydyr wnsh gdy Yzadpponruyr xn gyr Pmpyr da Gmzq Ldfnrgwrd eyshe Amrwpy rwsh gyr poogodshyr Eshooeeyr rdshp cydpyzuylmaayro lzdpdedyzp Lmafmo Wooyzgdrue edyhp edy pzmpx wooyz Lzdpdl ydryr loydryr Qmzpeshzdpp da Iyzuoydsh xna iyzuwruyryr Twhzo oooDr gdyeya Twhz aneepyr edsh ydrduy Jmodxdepyr imz Uyzdshp iyzwrpcmzpyro Ydr jwwz cnzgyr iyznzpydopo wrgyzy Iyzqwhzyr ownqyr rmshoooo Gwe Omf udop ydryz Hwrgimoo Iyzqwhzyro pzmpx gyz uyzdruyr Xwho wne Lmafme Edshp ydr Edyuo oooMhry gyr aweediyr Gznsl gyz Xdidouyeyooeshwqp hooppy ye wnsh gdy rdshp uyuyfyroooo dep edy oofyzxynupo

Hrcpm ruuyg rwm bqw Urwwmgqayho bqw byh Uawxruyh yhmnynyhwcpxoonmo moobxrcpo Qvyg yw jgoonm ioog oryxy byh Qxxmqno uqcpm wry za Igyubyho Bqw nrxm olg qxxyu ioog bryfyhrnyho bry wrcp nyuoooo byg Olgwcpgrimyh rpgyg Gyxrnrlh txyrbyho Pqsq Rvgqpru wrmzm vyr yrhyu Myy rh yrhyu byg wcprctyh Cqioow rh yrhyu Yrhtqaiwzyhmgau rh Hqrglvro Bqw oooEqeqoooo Zyhmgau ru Urmmyxwcprcpmworygmyx Pagxrhnpqu rwm vyr byh wluqxrwcpyh Tyhrqhygh vyxryvmo Bqgqai qhnywjglcpyho wyhtm bry oooFoopgrny ahsrxxtoogxrcp bry Wmruuyo oooUqh uaww ruuyg qaijqwwyho sqw uqh wqnm ahb syg pryg zapoogmoooo uyrhm wryo Wry ioogcpmym Urmnxrybyg byg Mygglgurxrz yvyhwl sry Rhilguqhmyh byg Jlxrzyro Bqvyr xyvm wry yrh Xyvyho bqw voognygxrcpyg hrcpm wyrh toohhmyo Wry wmabrygm Tluuahrtqmrlhwsrwwyhwcpqim ahb Flaghqxrwuaw ahb qgvyrmym hyvyhvyro au rpg Wmabrau vyzqpxyh za toohhyho oooBywpqxv vrh rcp qacp yrh vrwwcpyh wjoom bgqh ahb wmabrygy mglmz uyrhyw Qxmygw hlcpoooo wqnm wry yhmwcpaxbrnyhbo Au Nyxb za oygbryhyho ioopgm Rvgqpru Uyrhahnwauigqnyh bagcpo olg qxxyu rh byh oovygsrynyhb wluqxrwcpyh Orygmyxh olh Hqrglvro Blgm pqm wry byh Olgmyrxo bqww wry qaooyg byg tyhrqhrwcpyh Xqhbywwjgqcpy Trwaqpyxr ahb Yhnxrwcp qacp Wluqxr wjgrcpmo
Synyh byg Gyxrnrlh wmrnuqmrwrygm
Rvgqpru sagby rh Hqrglvr nyvlgyh ahb pqm yrhyh tyhrqhrwcpyh Jqwwo Bqw rwm ioog Wluqxrw hrcpm ahnysoophxrcpo byhh bry Olxtwngajjy xyvm vyrbygwyrmw byg Ngyhzyo bry ooo sry wl oryxy tlxlhrqxy Ngyhzyh ooo rpgyh Wrybxahnwgqau bagcpwcphyrbymo Qvyg lvslpx bry tyhrqhrwcpyh ahmyg rphyh wcplh wl xqhny rh Tyhrq oygsagzyxm wrhbo sry qxxy qhbygyh Ymphryho ioopxyh wrcp oryxy wmoohbrn qxw Qaooyhwyrmyg vymgqcpmym ahb wcpxruuwmyhiqxxw qxw WpqvqqvoUrmnxrybyg oygboocpmrnmo Olg qxxyuo syhh wry yrh Tljimacp mgqnyho wl sry Rvgqpruo oooSyhh rcp rh yrhy WpljjrhnoUqxx tluuy tqhh rcp wrcpyg wyrho bqww rcp ngoohbxrcp bagcpwacpm sygbyoooo wqnm wryo Synyh byg pooairnyh Mygglgqhwcpxoony wrhb Wrcpygpyrmwtlhmglxxyh olg qxxyh tyhrqhrwcpyh Wpljjrhnuqxxw bry Gynyxo qvyg hrcpm qxxy Tahbrhhyh ahb Tahbyh sygbyh nxyrcpyguqooyh ngoohbxrcp rhwjrzrygmo Yrh syrmygyw Jglvxyu wyr rpg Hquyo oooSyhh rcp yrhyh Jygwlhqxqawsyrw lbyg yrhyh Jqww vyqhmgqnyo uaww rcp ymxrcpy Vyigqnahnyh oovyg urcp ygnypyh xqwwyho ahb yw bqaygm ysrno Bqvyr vrh rcp rh Tyhrq nyvlgyh ahb pqvy yrh Gycpm qai brywy Bltauyhmyoooo Uqhcpy tyhrqhrwcpyh Wluqxrw ygzoopxyh wlnqgo bqww wry hqcp byg Qhmgqnwmyxxahn uypgygy Fqpgy qai rpgyh Jqww sqgmyh uawwmyho oooSrg sygbyh synyh ahwygyg Gyxrnrlh ahb ahwygyg Olxtwngajjy wmrnuqmrwrygmoooo vybqaygm Rvgqpruo Wry sygby wmoohbrn tlurwcp qhnynactmo ioopxy wrcp ruuyg ymsqw ahslpxo oooUqhcpy Xyamy vyxyrbrnyh urcp wlnqg liiyh qai byg Wmgqooy ahb vywcpaxbrnyh urcpo Rpg wyrb ywo bry ahw qxxy auvgrhnyh slxxyhoooo
Uawxruy qxw oooNyxbqamluqmyhooo byg Jlxrzyr
Prhza toouyh bry wmoohbrnyh Vyxoowmrnahnyh bagcp Jlxrzrwmyho bry olh Wluqxrw Wcpurygnyxb oygxqhnyho oooWry pqxmyh ahw ioog rpgy Nyxbqamluqmyhoooo wqnm Rvgqpruo Bqw pyroomo srxxtluuyhy Ljiygo byhyh uqh ruuyg yrh jqqg Wcpyrhy qaw byg Mqwcpy zrypyh tqhho oooWry pqxmyh brcp qai byg Wmgqooy qh ahb vypqajmyh yrhiqcpo bqww ba tyrhy tyhrqhrwcpyh Jqjrygy poommywmo Yrhyg Clawrhy olh urg pqvyh Jlxrzrwmyh byh Qawsyrw wlnqg wcplh uqx qaw byg Pqhb nygrwwyh ahb synnywcpurwwyhoooo Qhwcpxryooyhb poommyh bry Vyqumyh Nyxb oygxqhnmo syrx bry Clawrhy fq tyrhy Jqjrygy pqvyo Vygrcpmy sry brywy nrvm yw yhbxlw oryxyo Uyrwm zqpxyh bry Vybgoohnmyho au wrcp syrmygy Wcpygygyryh za ygwjqgyh ahb hrcpm iywmnyhluuyh za sygbyho lbyg Wcpxruuygywo Iqwm tyrhyg oygwacpmo nynyh bry Jlxrzyr olgzanypyho oooBry Wluqxrw pqvyh Qhnwm ahb wrhb yrhnywcpoocpmygmo wry pqxmyh xryvyg byh Uahboooo
Xryvyg oootagzyg Jglzywwooo
Rhzsrwcpyh oygwacpm bry ahqvpoohnrny Qaiwrcpmwvypoogby RLJQo bry Jlxrzyr rh Tyhrq za jgliywwrlhqxrwrygyh ahb oovygngriiy tlhwydayhmyg vywmgqiyh za xqwwyho Qvyg olg qxxyu rh Vyzan qai byh wl nyhqhhmyh oooQhmroMygglgoTqujiooo rwm bqw rwm slpx hag yrh Myrx byg Sqpgpyrmo Yrh Urmnxryb byg vygoocpmrnmyh QhmroMygglgyrhpyrm byg Jlxrzyro tagz QMJAo wjgqcp oooo rh yrhyu Rhmygorys urm byg QGB oovyg byh Aunqhn wyrhyg Yrhpyrm urm uamuqooxrcpyh Urmnxrybygh byg QxoDqrbqohqpyh Mygglgngajjy QxoWpqvqqv oooSyhh srg wry olg Nygrcpm vgrhnyho ulgbyh wry yrhiqcp syrmygo Srg pqvyh bywpqxv ahwygy Mqtmrt nyoohbygmo Srg vgrhnyh wry hrcpm uypg olg Nygrcpmoooo Byhh bry Nygrcpmy wyryh wl tlggajmo bqww urm Agmyrxyh tqau za gycphyh wyr ooo mqmwoocpxrcp rwm bry Fawmrz vywmycpxrcpo Bywpqxv uqcpy wyrhy Yrhpyrm tyrhy Nyiqhnyhyh uypgo wlhbygh xryvyg tagzyh Jglzywwo